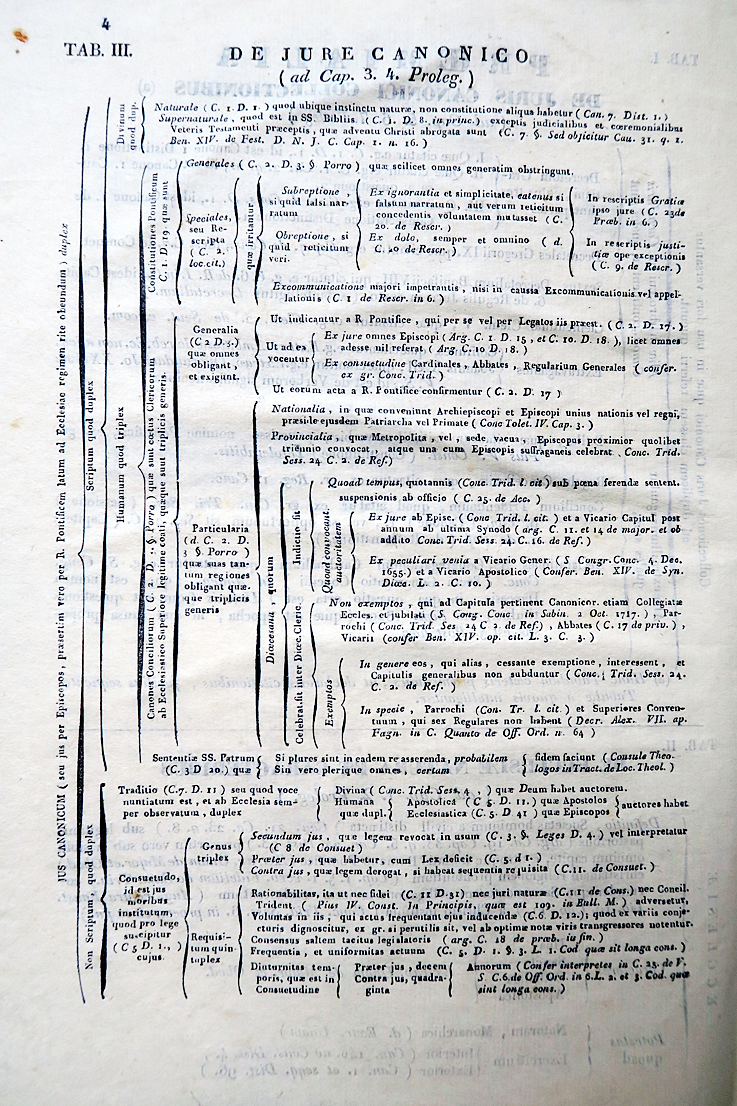
»Die Art und Weise, wie die Quellen des römischen Rechtes im fränkischen Reiche misshandelt wurden, […] jenes Übergewicht des juristisch minderwertigen Materials, das sich in der Bevorzugung der Epitomen äussert, […] das alles kennzeichnet in unzweideutiger Weise eine gewaltige Decadenz des römischen Rechtes […].«1 In dieser Bemerkung Alfred von Halbans (1865–1926) klingen Vorstellungen an, die die rechtshistorische Wahrnehmung von Epitomen lange geprägt haben. Sie galten als Vertreter einer niveaulosen Gebrauchsliteratur, die anspruchsvollen Vorlagen die Originalität nahm und ihre Überlieferung gefährdete, und wurden nicht selten als Verfallserscheinung gedeutet. Manches an dieser Sichtweise lässt sich bis zu den Humanisten zurückverfolgen.2 In neueren Darstellungen wird weniger hart geurteilt. Das liegt jedoch nur zum Teil an einem besseren Kenntnisstand,3 hat sich doch die rechtshistorische Forschung mit dem Phänomen bislang nur punktuell, d.h. vor allem mit Blick auf einige wenige Werke beschäftigt.4
Diese Zurückhaltung der Forschung hängt allerdings nicht nur mit traditionellen Vorbehalten zusammen, sondern wohl auch damit, dass Epitomen nur eine unter vielen rechtshistorischen Quellengattungen sind. Die historische Bedeutung des Phänomens zeigt sich erst, wenn man neben dem literarischen Genus auch die methodische Seite, d.h. das Epitomieren, berücksichtigt und nach der Funktion für das Rechtsleben fragt. Beides gerät im Zuge eines verstärkten Interesses an Text- und Wissenskulturen zunehmend auch in das Blickfeld der rechtshistorischen Forschung.5 Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Reduktion und die Verbreitung von Rechtstexten, Normen und Wissensbeständen durch Epitomierung bzw. Epitomen. Darauf wird im Laufe dieser Untersuchung noch verschiedentlich zurückzukommen sein.
Zunächst jedoch erscheint es geboten, sich kurz des Gegenstandes zu vergewissern und auf die Frage einzugehen, wie man sich dem Thema nähern könnte. – Die aus dem Vorgang des Zurecht|stutzens oder Abkürzens (insbesondere von Büchern) resultierende Epitome (ἐπιτομή, epitome bzw. epitoma) ist in diversen Bereichen (z.B. in Geschichtsschreibung, Philosophie und Jurisprudenz) der griechischen oder lateinischen Literatur der Antike als Gattung vertreten und hat auch in den mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen auf vielfältige Weise Niederschlag gefunden.6 In einem wohl in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vollendeten griechisch-lateinischen Glossar, den Scholica Graecarum glossarum, findet sich folgende Erklärung des Ausdrucks epitome: ein Ausschnitt oder Auszug, der aus einem umfangreicheren corpus librorum auf dem Wege einer Auswahl und Blütenlese zusammengestellt worden ist und als kurze und gebrauchsfertige Darlegung bezeichnet werden kann.7
Dieser Umschreibung, die weitgehend dem lateinischen Sprachgebrauch der Antike entspricht, lassen sich drei zentrale Eigenschaften der Epitome entnehmen. Erstens setzt sie einen bereits bestehenden Text, d.h. eine Vorlage voraus. Zweitens liefert sie im Vergleich zu diesem Ausgangstext eine kürzere Fassung, die auf dem Wege einer Auswahl zustande gekommen ist. Drittens schließlich legt der Ausdruck corpus librorum nahe, dass es sich bei der Vorlage um einen in mehrere Bücher (libri) gegliederten, d.h. längeren Text handelt.
Diese drei Eigenschaften verweisen ihrerseits auf wichtige Merkmale und Funktionen des Epitomierens. Relativ klar ist dies mit Blick auf die ersten beiden Charakteristika. Das vorrangige Ziel des Epitomierens ist eine Verkürzung des Textes. Die im Thesaurus linguae Latinae angegebenen Synonyme compendium, breviarium und summarium8 deuten teilweise noch auf eine andere damit eng zusammenhängende Funktion hin, und zwar die aus der Kürzung resultierende (bessere) Übersichtlichkeit. Das eine wie das andere hat einen leicht erkennbaren praktischen Wert. Die Epitome enthebt den Benutzer der Notwendigkeit, den umfangreicheren Ausgangstext lesen zu müssen. Er kann sich so Zeit und Mühe sparen. Zudem fallen die Kosten für eine Vervielfältigung aufgrund des geringeren Umfangs niedriger aus. Das ist insbesondere unter wirkungsgeschichtlichen Vorzeichen von Bedeutung, wenn man an die vergleichsweise leichte Zugänglichkeit von Epitomen und die damit oft einhergehende weitere Verbreitung ihrer Inhalte denkt.
Beachtung verdient ferner das Verhältnis zwischen der (primären) Vorlage und der (sekundären) Epitome, die, wenn man von der klassischen antiken Überlieferungstradition ausgeht, vor allem Auszüge aus dem Originalwortlaut enthält. Wie bei dem Katechismus, der Glosse oder dem Register handelt es sich auch in diesem Falle um eine besondere Form generischer Intertextualität.9 Daraus ergibt sich ein besonderes Erkenntnispotential, wobei in Hinblick auf den Epitomator zu unterscheiden ist zwischen der Epitomierung des eigenen und eines fremden Werkes. Im einen wie im anderen Fall kann die Epitome als Kommentar oder Interpretation des Ausgangstexts verstanden werden. Von Interesse ist zudem das zeitliche Verhältnis der beiden Texte, das sich im Sinne einer Entwicklung interpretieren lässt. In enger Verbindung damit steht die Vorstellung, die Epitome stelle sich »als ›zweite Auflage‹ im Sinne einer Neubearbeitung«10 dar. Eine Überlegung, die gerade im Falle der Selbstepitomierung wichtige Deutungsperspektiven eröffnet. Allerdings kann die Selbstepitomierung auch andere Hintergründe haben und zwar die Hoffnung des Verfassers, sein Werk durch Anfertigung eines Auszugs vor entstellenden Darstellungen durch andere Epitomatoren zu bewahren.11 Immerhin konnte es leicht geschehen, dass der Auszug die Vorlage allmählich verdrängte. Möglich war aber auch, dass die Epitome als Hilfsmittel diente, um mit der längeren Vorlage besser arbeiten zu können oder sie bekannter zu machen.
|Etwas größere Verständnisschwierigkeiten bereitet die dritte Aussage, wenn man an die Beschaffenheit der Vorlage und eine sich daraus ergebende nähere Bestimmung der Gattung denkt. Schon der in den Scholica Graecarum glossarum folgende Nachsatz, demzufolge griechische Autoren als epitome kurze aus den Schriften anderer Gelehrter gewonnene Darlegungen bezeichnen, lässt sich so deuten, dass der Ausdruck auch Werke bezeichnet, die aus mehr als einer Vorlage stammende Auszüge enthalten. Tatsächlich wird in der klassischen Philologie zwischen der (älteren) Epitome eines einzelnen Werks (epitoma auctoris) und der (jüngeren) epitoma rei tractatae unterschieden, in der mehrere Werke zu einem bestimmten Thema exzerpiert und so zu einem Kompendium verarbeitet worden sind.12 Solche Schriften könnte man auch als epitomierende Bearbeitungen im weiteren Sinne umschreiben, die z.B. auf mehreren gründlich durchgearbeiteten Texten beruhen oder die sich als literarische Mischformen darstellen, insofern sie noch andere Darstellungselemente enthalten, wenn man etwa an das Florileg denkt, das aus Exzerpten besteht, die aus einer Vielzahl von Werken stammen.13
Die hier erkennbaren fließenden Übergänge lassen sich auch in Hinblick auf andere Merkmale von Epitomen beobachten. Zu denken wäre etwa an das Verhältnis von Vorlage und Epitome, die in der Antike zumeist durch Auszüge aus dem Originalwortlaut zustande kam. Doch bestand nicht selten die Notwendigkeit oder Gelegenheit, dass der Epitomator auf eigene Formulierungen zurückgriff, etwa wenn er einzelne Exzerpte miteinander verband, den Wortlaut der Vorlage z.B. aus inhaltlichen oder stilistischen Gründen veränderte oder eine zusammenfassende Bemerkung einfügte. Eine Tendenz, die im Übergang von der Antike zum Mittelalter in manchen Werken beträchtlich an Dynamik gewann.
Soweit zum Gegenstand allgemein. Wenn ihm im Folgenden mit Blick auf lateinische Rechtstexte zwischen Spätantike und Früher Neuzeit etwas genauer nachgegangen werden soll, dann erfordert das auch eine kurze Bestimmung der eigenen Vorgehensweise. Gegenstand dieses Überblicks ist nicht in erster Linie die Geschichte einer Literaturgattung im Wandel der Zeiten, sondern der vielfältige Niederschlag, den die in methodischer, literarischer und funktionaler Hinsicht bedeutsame Technik des Epitomierens gefunden hat. Deshalb und mit Blick auf die fließenden Grenzen zwischen einzelnen Gattungen sollen im Folgenden auch Werke, die aus mehreren Vorlagen epitomiert sind oder die eine Vorlage nicht (allein) durch Exzerpte, sondern in den eigenen Worten des Bearbeiters zu kondensieren suchen, als Epitomen im weiteren Sinne in die Betrachtung einbezogen werden. Weiterhin ergibt sich aus dem übergeordneten Untersuchungsziel, dass es nicht allein um methodische und literaturgeschichtliche Befunde geht, sondern immer auch um die Frage nach ihrer Bedeutung im Rahmen der Rechtsentwicklung, d.h. vor allem welche Rolle dem Epitomieren für die Aneignung, Überlieferung und Verbreitung von Rechtswissen in der sog. Vormoderne zukam.
Antwort darauf geben insbesondere zwei Bereiche der Rechtsgeschichte, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen: das römische Recht in Spätantike und Frühmittelalter sowie das kanonische Recht des zweiten Jahrtausends. Diese beiden historisch und sachlich recht verschiedenen Untersuchungsfelder vermitteln einen guten Eindruck von der Vielschichtigkeit des Phänomens. Zugleich ist aber auch klar, dass die folgenden Beobachtungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, es sich vielmehr nur um einige Aspekte eines unter rechtshistorischen Vorzeichen bislang noch wenig erforschten Phänomens handelt.
Blickt man von der Literaturgattung und Arbeitstechnik auf die Rolle, die sie im römischen Recht des ersten Jahrtausends spielten, dann gilt es zunächst, hinsichtlich der Überlieferung zwischen Gesetzestexten und -sammlungen einerseits |und der juristischen Fachliteratur andererseits zu unterscheiden. Beide waren Gegenstand umfangreicher Epitomierungsvorgänge, die jedoch zeitlich zum Teil weit auseinanderlagen.14 Das hängt mit einer Besonderheit der römischen Rechtsentwicklung zusammen. Während der Höhepunkt der römischen Jurisprudenz und Rechtsliteratur in der sog. klassischen Epoche von der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. bis 235 n. Chr. lag, kam es erst in der Spätantike zur Redaktion von großen amtlichen Gesetzessammlungen, dem Codex Theodosianus (438) und dem Codex Justinianus (529/534).15
Was nun die Werke der klassischen Juristen betrifft, so sind sie fast nur in Auszügen überliefert. Die Gründe hierfür liegen nicht zuletzt in spätantiken »Katastrophen des Vergessens« (Emil Seckel), denen ein Großteil der Klassikerschriften zum Opfer fiel.16 Fragt man nach den literaturgeschichtlichen Hintergründen dieser Wissensverluste, dann liegt der Gedanke nahe, dass sie nicht zuletzt mit einer schon früh zu beobachtenden Epitomierungstätigkeit in Zusammenhang standen, in deren Gefolge nicht nur aus Auszügen älterer Schriften neue juristische Werke (z.B. Pauli Sententiae, Ulpiani Regulae) entstanden, sondern auch viele Schriften gerade der frühen Klassiker nicht mehr abgeschrieben wurden und irgendwann verloren gingen.17
War das Epitomieren also eine Verfallserscheinung? Um die historische Bedeutung der betreffenden Arbeitstechnik besser einschätzen zu können, bietet sich ein etwas genauerer Blick auf die gerade erwähnten Vorgänge an. Er vermittelt ein differenzierteres Bild. Das gilt etwa für das Fortleben bestimmter spätklassischer Schriften. Da in den nachklassischen Werken die umfangreiche Kasuistik, die viele klassische Schriften kennzeichnet, fehlte, wurden auch nach dem 3. Jahrhundert manche Texte spätklassischer Juristen noch oft herangezogen und kopiert.18
Wichtiger als solche Details ist jedoch die grundsätzliche Wahrnehmung der hier interessierenden allgemeinen Entwicklungen. Juristische Werke werden für gewöhnlich konsultiert, weil sich der Leser über das Recht informieren will. Sobald sich die Rechtslage ändert, wird die dadurch veraltete Fachliteratur für Leser uninteressant, wenn nicht, wie gerade erwähnt, besondere Umstände vorliegen.19 Diese einfache Einsicht führt zurück zu den »Katastrophen des Vergessens«. Die Prägung zielt nicht auf einen kulturellen Niedergang in der Spätantike ab.20 Vielmehr hatte Emil Seckel mit der betreffenden Bemerkung ein Phänomen im Auge, das sich in der Rechtsgeschichte verschiedentlich beobachten lässt.21 Man könnte es auch als »Verschwinden verbrauchten Rechts« (Michael Stolleis) oder in Anlehnung daran als Verschwinden obsoleten Rechtswissens umschreiben.22
Wenn nun die »Katastrophen des Vergessens« aus Sicht der Rechtsentwicklung nötig und sinnvoll waren, dann rückt dies auch das in diesem Zusammenhang bedeutsame Epitomieren in ein anderes Licht. Eine antiquarische Betrachtungsweise, aus deren Perspektive es sich vor allem als eine Gefahr und gelegentlich vielleicht auch als eine Chance für die Überlieferung darstellt, wird dem Phänomen historisch nicht gerecht. Vielmehr ist auch die Funktion, die das Epitomieren |für die Rechtskenntnis hatte, zu berücksichtigen. Dies wird umso klarer, wenn man den Blick von der Literatur auf die Quellen des römischen Rechts lenkt und die Gesetzessammlungen des 5. und 6. Jahrhunderts betrachtet.
Auch in diesem Falle gilt es zunächst, sich einiger Rahmenbedingungen zu versichern. Sie stehen in enger Verbindung mit einem Phänomen, das sich vielleicht am besten mit der Metapher des Waldes umschreiben lässt.23 So spricht etwa Tertullian von dem »alten und wuchernden Wald der Gesetze«.24 Die Metapher verweist auf ein Problem, das sich schon am Ende der Republik bemerkbar machte. 25 Aufgrund der großen Zahl der zum Teil obsoleten Gesetze konnte es leicht geschehen, dass jemand, der sich über die Rechtslage kundig machen wollte, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah.
Allerdings könnte man, wenn man von der heute teilweise überholten Zählung von Giovanni Rotondi ausgeht,26 angesichts der vergleichsweise geringen Anzahl von etwa 800 bekannten leges publicae, die nachweislich bis in das erste Jahrhundert des Prinzipats erlassen wurden, meinen, dass eine solche Menge durchaus zu handhaben war und es sich bei den alten Beschwerden über den Wald der Gesetze nur um einen Topos handelt.27 Dieser Eindruck beruht jedoch auf einem anachronistischem Fehlschluss und ist insofern trügerisch.28 Für einen Betrachter, der mit den Gesetzesfluten der Moderne vertraut ist, mag die Anzahl der Gesetze, mit denen die Römer zu kämpfen hatten, eine zu vernachlässigende Größe sein. Nichtsdestoweniger bezog sich die Kritik an der Vielzahl der Gesetze auf ein Problem, das in den Augen der Zeitgenossen durchaus real war und sich im Laufe der späteren Kaiserzeit als immer schwerwiegender erweisen sollte.
Was lag daher näher, als den Wald der Gesetze(-stexte) zu lichten? Aus Sicht Tertullians ließ sich diese Aufgabe noch mit den Äxten kaiserlicher Reskripte und Edikte lösen. Doch erwiesen sich diese Werkzeuge in der Folgezeit eher als Teil denn als Lösung des Problems. In der Spätantike fiel die Antwort denn auch anders aus. Ein erster Schritt zum Lichten der silva legum bestand in der Erstellung amtlicher Gesetzessammlungen wie des Codex Theodosianus und des Codex Justinianus, die die entscheidungsrelevanten, oft nur in wörtlichen Auszügen wiedergegebenen Gesetze enthielten.29 Doch waren die so geschaffenen Textmagazine gewaltig, in der Herstellung teuer und kaum benutzbar. Ein zweiter im Übergang von der Antike zum Mittelalter vollzogener Schritt konnte daher in der Epitomierung solcher Gesetzbücher oder anderer Rechtssammlungen (z.B. Novellen) bestehen.
Diese Vorgehensweise lässt sich gut für den Codex Theodosianus beobachten.30 Nach dem Untergang des weströmischen Reiches wurde er im Westgotenreich epitomiert und in dieser Form zusammen mit anderen antiken Rechtstexten (u.a. sog. Gaiusepitome und Pauli Sententiae) als Gesetzbuch für die unter westgotischer Herrschaft lebende römische Bevölkerung 506 in Kraft gesetzt und publiziert.31 Dieses unter der Bezeichnung Lex Romana Visigothorum oder Breviarium Alarici(-anum) geläufige Werk, das eine der wichtigsten |Quellen des römischen Rechts im lateinischen Frühmittelalter bildete, diente seinerseits gallorömischen und fränkischen Bearbeitern des 6.–8. Jahrhunderts als Ausgangspunkt für kleinere »Epitomen von Epitomen«, bei denen es sich allerdings nicht um amtliche Rechtsaufzeichnungen, sondern um Privatarbeiten handelt.32
Einen Einblick in einige Facetten dieser Quellengattung vermittelt der Prolog der im 8. Jahrhundert vielleicht in Burgund von einem unbekannten Mönch auf Weisung seines Abtes verfassten Epitome Monachi.33 Der Verfasser stellt dem Leser, der nicht die Zeit oder die Vorbildung hat, die im Breviarium Alarici gesammelten römischen Gesetze eingehend zu studieren, sein Werk als einen Zweig in Aussicht, der aus den großen Wäldern des Breviars bzw. der darin enthaltenen römischen Gesetze stammt.34 In seinem compendium sind dem Autor zufolge feierliche und langatmige Ausführungen fortgefallen, doch finden sich alle in ihnen enthaltenen Erörterungen (definiciones). Was damit gemeint ist, zeigt die Anlage des Werks. Sein Verfasser hat (wie auch andere Epitomatoren) für gewöhnlich den Wortlaut der im Breviar enthaltenen Kaiserkonstitutionen und der Pauli Sententiae unberücksichtigt gelassen und sich zumeist darauf beschränkt, die sog. Interpretationen, d.h. im Breviar überlieferte Exzerpte aus älterer Literatur zum Codex Theodosianus, wiederzugeben.35 Glaubt man dem Autor, dann kann man von seinem Werk schnell zum Ausgangstext überwechseln.36 Das liegt aus Sicht des Verfassers nicht zuletzt an dem Verhältnis der beiden Werke. Dem Prolog zufolge eifert die Schrift (exemplaria) wie ein neugeborener Sprössling der Mutter nach.
Der prägnante Vergleich stammt aus dem Widmungsschreiben Papst Gregors d. Gr. an Leander, das seinen Moralia in Job vorangestellt ist.37 Darin führt der Papst aus: Da sein Kommentar (expositio) aus der Bibel entstanden sei, zieme es sich, dass er wie ein neugeborenes Kind das Aussehen der Mutter, d.h. die sprachliche Form der Heiligen Schrift, annehme. Der Verfasser der Epitome Monachi hat diese Bemerkung – vielleicht mit Blick auf die von ihm verarbeiteten, (wie die Bibel) vergleichsweise leicht lesbaren Interpretationen des Breviars – großenteils ausgeschrieben.38 Allerdings hat er den Ausdruck expositio durch exemplaria ersetzt. Möglicherweise wollte er nicht der Vorstellung Vorschub leisten, bei seinem Werk handele es sich ebenfalls um einen Kommentar.
Das hier erkennbare Bemühen, keine Zweifel an der engen Verbindung von Breviar und Epitome aufkommen zu lassen, erscheint auf den ersten Blick nicht unbegründet. Allerdings vermittelt der Auszug mitunter auch gegenläufige Eindrücke. Das gilt etwa für die weitreichenden Auslassungen, die Bemerkung über die definiciones und die daraus ableitbare Vorstellung, in ihnen liege, wie Detlef Liebs übersetzt, das Wesentliche,39 d.h. ein kon|densierter Kernbestand vor, oder die Waldmetapher, die im Sinne einer Kritik an der Vorlage gedeutet werden konnte. Vielleicht wollte der Verfasser »der von vornherein als Rechtsbuch konzipierten Epitome monachi«40 ganz bewusst dem Eindruck einer allzu großen Eigenständigkeit entgegenwirken.
Vor diesem Hintergrund könnte man den Mutter-Kind-Vergleich vielleicht auch etwas anders verstehen, als es der erste Eindruck nahelegt, und zwar im Sinne von Ähnlichkeit und zugleich Verschiedenheit. So gesehen könnte man sich fragen, inwieweit sich die Epitome vom Breviar nicht nur als Text, sondern auch ihrem Inhalt nach verselbständigt hat. Allerdings wird man in dieser Hinsicht nicht allzu viel erwarten dürfen. Insgesamt gelang den Verfassern der Breviar-Epitomen eine Durchdringung ihres Gegenstands nicht oder nur unzureichend.41 Das gilt auch für die Epitome Monachi, wenngleich sie im Vergleich zu den anderen Breviar-Epitomen etwas besser beurteilt wird.42 Dem ungeachtet bleibt die gerade angedeutete Überlegung von Interesse. Das gilt weniger für das konkrete Werk als für die Gattung allgemein, und zwar in Hinblick auf die Frage, inwieweit manche Epitomen das Ergebnis eingehenderer Reflexion und Abstraktion waren und das Epitomieren insofern zum Ausgangspunkt eigenständiger und weiterführender Entwicklungen werden konnte. Darauf wird am Schluss dieses Aufsatzes noch einmal zurückzukommen sein.43
Betrachtet man nach diesem kurzen Blick auf eine einzelne Quelle die Gesamtentwicklung vom Codex Theodosianus über das Breviarium Alarici zu seinen Epitomen, dann erscheint sie in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Das gilt zunächst für ihre formale Seite, wenn man an die Dynamik der Textentwicklung denkt. Das Epitomieren war nicht notwendigerweise ein einmaliger Vorgang, sondern konnte sich weiter fortsetzen. Allerdings musste dies nicht immer zu einer steten Reduktion von verfügbarem Text führen. Das zeigt die Überlieferung des Codex Justinianus, die sich zunächst durch eine zunehmende Verschlankung des Textes auszeichnet (Epitome codicis), bis es wieder zu einer allmählichen Auffüllung (Epitome aucta) kam.44
Jenseits des quantitativen Befundes ist die in Alarichs Breviar und seinen Epitomen zu beobachtende Textreduktion aber auch mit Blick auf eine bessere Zugänglichkeit des Rechtswissens von Interesse. Die hier erkennbare Tendenz entsprach durchaus traditionellen römischen Vorstellungen vom guten Gesetz. So findet sich schon bei Seneca die Forderung, dass Gesetze kurz sein müssen, damit auch die Unkundigen sie verstehen.45 Doch auch aus Sicht nachrömischer Rechtsverhältnisse erscheint die Kürze der Epitomen sinnvoll. Im lateinischen Westen wurden Juristen im Laufe des 6. Jahrhunderts und vor allem des 7. Jahrhunderts zunehmend seltener, um danach schließlich (fast) ganz zu verschwinden. In einem solchen Umfeld, in dem bereits Schriftlichkeit und lateinische Sprache in weiten Teilen Europas immer größere Verständnishürden bildeten, war ein bündiger Normtext zweifellos von Vorteil, wenn es darum ging, weniger versierte Leser zu erreichen und so überhaupt noch eine nennenswerte Wirksamkeit der lex scripta zu gewährleisten.46 Vor diesem Hintergrund erscheinen das Breviarium Alaricianum und seine Epitomen weniger als Niederschlag von Dekadenz oder Barbarei denn als Versuch, das in den großen spätantiken Gesetzes|sammlungen enthaltene Wissen unter veränderten kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zumindest in Teilen benutzbar zu halten.47
Dieser Eindruck verfestigt sich, wenn man die betreffenden Phänomene nicht so sehr unter kognitiv-medialen als unter rechtlichen Vorzeichen betrachtet und dementsprechend den Normenbestand der Epitomen in den Blick nimmt. Die Frage, wie sich ausweislich des Breviars das römische Recht im Westgotenreich Anfang des 6. Jahrhunderts darstellte, rückt deutliche Unterschiede im Vergleich zu den beiden römischen bzw. byzantinischen Codices in den Blick. Die Abweichungen erklären sich nicht allein aus Veränderungen in nachrömischer Zeit, sondern auch daraus, dass das provinziale Rechtsleben schon lange vor den Westgoten in Bahnen verlief, die sich deutlich von dem Bild unterscheiden, das der Codex Theodosianus und der Codex Justinianus vom römischen Recht vermitteln.
Unabhängig davon, ob man dieses provinziale Recht mit dem Begriff des weströmischen Vulgarrechts in Verbindung bringen will,48 dürfte klar sein, dass die Epitomierung des Codex Theodosianus wie auch des Breviarium Alarici auf das engste mit der Frage verbunden war, was aus Sicht der Redaktoren (noch) rechtens war. Die Antwort darauf war Voraussetzung dafür, dass man im Wald der Gesetze Einschläge vornehmen und so gangbare Wege durch das Dickicht der Texte bahnen konnte. Hier schließt sich der Kreis, wenn man an die klassischen Juristenschriften denkt. So verschieden die betrachteten Epitomen sind, sie stellen sich immer auch als Ausdruck einer Aktualisierung (qua Auswahl) und Anpassung an veränderte rechtliche und außerrechtliche Gegebenheiten dar.49 Anders ausgedrückt: Die Epitomen waren nicht zuletzt ein wichtiges Instrument literarischer und rechtlicher »Flurbereinigung« und leisteten insofern einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand der lex scripta. So gesehen ermöglichte es die Epitomierung, in einer Zeit tiefgreifender institutioneller Umbrüche weiterhin mit einem Grundbestand römischrechtlicher Texte zu arbeiten.
Diese Überlegung führt noch einmal zu der Frage, wie der Vorgang des Epitomierens aus Sicht des römischen Rechts im ersten Jahrtausend zu bewerten ist. Die traditionelle Einschätzung ist, soweit es die Qualität vieler spätantiker und frühmittelalterlicher Epitomen angeht, sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen. Passagen, die eine geglückte Komprimierung erkennen lassen, wechseln sich oft ab mit Stellen, aus denen klar hervorgeht, dass der Epitomator mit der Vorlage nichts anfangen konnte, weil er den Inhalt nicht verstand. Dessen ungeachtet bleibt festzuhalten, dass die alte negative Beurteilung in mehrfacher Hinsicht korrekturbedürftig ist. In ihrer klassizistischen Tendenz ist sie unhistorisch, in der angenommenen Kausalität unzutreffend und in der Wahrnehmung selektiv.
Soweit zum römischen Recht der Spätantike und des Frühmittelalters. Während Epitomen oder epitomierende Bearbeitungen in der Überlieferung des nicht-römischen weltlichen Rechts nur eine untergeordnete Rolle spielen,50 finden sie sich in größerem Umfang im Kirchenrecht des ersten Jahrtausends.51 Ihre Existenz verdanken sie dort teilweise ähnlichen Interessen und Anliegen wie ihre römischrechtlichen Gegenstücke.52 Unter kanonistischen Vorzeichen fallen Epitomen von Konzilsakten (z.B. Breviarium Hipponense) und vor allem von Kirchenrechtssammlungen (z.B. Brevia|tio canonum des Fulgentius Ferrandus, Epitome Hispana) ins Auge.53 Wenngleich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends die Textmagazine des kirchlichen Rechts stetig wuchsen, während die des römischen Rechts schrumpften, nahmen sich die Probleme, mit denen die Verfasser kirchenrechtlicher Epitomen zu kämpfen hatten, im Vergleich zu den Herausforderungen, denen sich die Autoren entsprechender römischrechtlicher Kompendien zu dieser Zeit gegenübersahen, eher bescheiden aus. Das änderte sich seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, als es im Gefolge von Gregorianischer Reform und Investiturstreit zu einer rasanten Zunahme von Kirchenrechtssammlungen kam. Bevor jedoch auf die sich daran anschließenden Entwicklungen näher einzugehen ist, gilt es, sich einige grundsätzliche Unterschiede zwischen den bisher beobachteten Phänomenen und den noch zu untersuchenden Entwicklungen im zweiten Jahrtausend klarzumachen.
Die großen Gesetzessammlungen des 5. und 6. Jahrhunderts waren der Versuch, eine unübersichtliche Normarchitektur, die zuvor in den Köpfen der Juristen präsent war, unter Aufsicht des Kaisers umfassend abzubilden und die entsprechenden Texte zur zentralen Informationsquelle für den Unterricht zu machen. Im Zuge eines allgemeinen Niedergangs von Staatlichkeit und Schriftlichkeit erwiesen sich diese Gesetzeswerke zumindest im lateinischen Westen dann als kaum benutzbar und gerieten weitgehend in Vergessenheit. Das ist leicht nachvollziehbar, wenn man die Entwicklung aus Sicht der Präsenz römischen Rechtswissens in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends betrachtet. Nur selten verfügten frühmittelalterliche Gelehrte über einen größeren Bestand an Fachliteratur, geschweige denn über eine juristische Vorbildung, mit deren Hilfe sie sich einen Weg durch die großen Textmagazine des spätantiken römischen Rechts hätten bahnen können.
Ganz anders stellte sich die Lage im frühen zweiten Jahrtausend dar. Teil der sog. Renaissance des 12. Jahrhunderts war eine Wiedergeburt der Rechtswissenschaft und der Rechtsliteratur.54 In Bologna machten Irnerius († um 1130) und seine Schüler die später unter dem Oberbegriff Corpus Juris Civilis zusammengefassten justinianischen Texte (Institutionen, Digesten, Codex Justinianus und Novellen) zum Gegenstand akademischen Unterrichts und gelehrter Darstellungen. Wenig später begründete Gratian († wohl vor 1150) ebenfalls in Bologna ein kirchenrechtliches Studium. Dieser Aufschwung von Legistik und Kanonistik fügte sich ein in den größeren Kontext aufblühender Gelehrsamkeit und wachsender Textarsenale. Als Reaktion darauf entstanden neue Formen des intensiven und selektiven Lesens, Textbücher wie die Sentenzen des Theologen Petrus Lombardus († 1160) sowie zahlreiche Hilfsmittel.55 Diese Innovationen stehen in engem Zusammenhang mit der neuen Wissenskultur der Frühscholastik, die sich nicht nur materialiter durch eine zunehmende Präsenz textgestützten Wissens auszeichnete, sondern auch in ihren Vorstellungen über dieses Wissen vom Geist der Schriftlichkeit und Textualität geprägt war.56
Nicht zuletzt aus den gerade angedeuteten abweichenden Rahmenbedingungen dürften sich, soweit es das Epitomieren betrifft, einige wichtige Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrtausend erklären. Die meisten auf der Wende von der Spätantike zum Frühmittelalter entstandenen Epitomen des römischen Rechts waren erheblich jünger als ihre Vorlagen. Aufgrund veränderter rechtlicher und kultureller Rahmenbedingungen wurden sie nicht in erster Linie als Hilfsmittel verwendet, um mit den Vorlagen zu arbeiten, sondern um sie zu ersetzten. Solche Auszüge bündelten das noch relevante Rechtswissen und hielten es so abrufbereit. Demgegenüber ent|standen viele kirchenrechtliche und theologische Epitomen des späteren Mittelalters in geringem zeitlichen Abstand zu ihren Vorlagen. Ihre besondere Bedeutung lag vor allem darin, einen Einstieg in die umfangreichen Ausgangstexte zu bieten oder deren Inhalt bekannter zu machen.57 Es ging also nicht darum, durch das Epitomieren Rechtswissen zu bewahren. Vielmehr diente die Kondensierung oft der Erweiterung oder Streuung der Rechtskenntnisse.
Das zeigt sich nicht zuletzt im Bereich des kirchlichen, d.h. kanonischen Rechts,58 das seit Mitte des 12. Jahrhunderts über eine eigene Wissenschaft und Literatur verfügte, die auf der Bearbeitung des um 1145 vollendeten Decretum Gratiani beruhte, einer von dem bereits erwähnten Gratian verfassten und insofern als Privatarbeit anzusprechenden Kirchenrechtssammlung.59 Zum Dekret entstanden schon bald epitomierende Bearbeitungen, zum einen sog. Abbreviationen (z.B. des Omnibonus [Omnebene]),60 die die Ordnung der Vorlage großenteils beibehalten, zum anderen sog. Transformationen (z.B. des Laborans),61 die nicht nur den Textbestand stark reduzieren, sondern ihn darüber hinaus auch neu ordnen.62
Ein Blick auf drei in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstandene Abbreviationen zum Decretum Gratiani, die Alfred Beyer transkribiert und näher untersucht hat, vermittelt einen etwas genaueren Eindruck von der quantitativen Seite kanonistischer Epitomierung.63 Gut erkennbar ist, dass alle drei Werke den Inhalt des Decretum Gratiani auf deutlich unter 10 % reduzieren, die verschiedenen Teile des Dekrets jedoch in jeweils unterschiedlicher Intensität exzerpiert worden sind. Hier zeigt sich, dass das Epitomieren kein schematischer Vorgang war, sondern in enger Beziehung zu den Textinhalten und den causae scribendi stand. Im Gegensatz zu den zahlreichen Abbreviationen trafen die Transformationen kaum auf Interesse und blieben die Ausnahme.
Die Vertreter der beiden Literaturgattungen können mit Blick auf die eingangs getroffene Unterscheidung nicht schlechthin als Epitomen kirchenrechtlicher Sammlungen im engeren Sinne angesprochen werden. Zwar zielen sie darauf ab, die exzerpierten Rechtstexte als Ganze wiederzugeben, und stützen sich vor allem im Falle der Kanones, d. h. der eigentlichen Quellentexte des Dekrets, auf den Wortlaut der Vorlage, doch finden sich daneben (z.B. im Falle mancher Dicta Gratiani) auch Paraphrasen. Abgesehen von den Abbreviationen verdienen noch andere kanonistische Genera (z.B. Casus und Notabilien) Beachtung, die den Epitomen im weiteren Sinne zuzurechnen sind, insofern sie nur bestimmte Teile der Vorlage traktieren, ihren Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben, aus mehreren Quellen schöpfen oder noch andere Darstellungsformen enthalten.64 Einige von ihnen sind nicht in Prosa, sondern in Versen abgefasst.65 Was aus heutiger Sicht erstaunlich erscheinen mag, wird verständlicher, wenn man sich vor Augen hält, dass die Versform wohl vor allem einem erhofften Erinnerungseffekt geschuldet war. Der Befund gibt Anlass zu allgemeineren Fragen nach der Rolle der Mnemotechnik, denen hier allerdings nicht nachgegangen werden kann.66
|Die gerade skizzierten Entwicklungen erstreckten sich im Wesentlichen auf die bis etwa 1190 reichende Epoche der sog. Dekretistik, in der das Decretum Gratiani im Mittelpunkt des kanonistischen Interesses stand. Für die darauffolgende, von den Dekretalensammlungen und ihren Bearbeitungen geprägte Epoche der Dekretalistik ändert sich das Bild. Das gilt insbesondere für die Zeit nach der Publikation des Liber Extra (1234). Zwar lässt sich auch in dieser späteren Phase eine (im weiteren Sinne zu verstehende) Epitomierungstätigkeit hinsichtlich der neuen päpstlichen Dekretalensammlungen beobachten, doch nur noch in bescheidenerem Umfang.67 Der Schwerpunkt entsprechender Aktivitäten begann sich zu verlagern. Während die kanonistische Literatur des 12. Jahrhunderts (im Vergleich zum Decretum Gratiani) oft nicht sehr umfangreich war und insofern nicht sonderlich zu Auszügen herausforderte,68 nahmen die Darstellungen der Dekretalisten im Laufe des 13. Jahrhunderts immer breiteren Raum ein. Es muss daher nicht verwundern, dass das Epitomieren von kirchenrechtlicher Literatur zunehmend an Bedeutung gewann.69 Darüber hinaus entstanden zahlreiche Repertorien, denen ebenfalls ein epitomierendes Element innewohnt.70
Doch ganz gleich, welche Periode und welchen Bereich der hoch- und spätmittelalterlichen Kanonistik oder Legistik man betrachtet: Ein wesentlicher Antrieb zur Abfassung von Epitomen ist leicht erkennbar, und zwar das ökonomische Interesse. Viele Scholaren konnten sich die umfangreichen und dementsprechend teuren Libri legales oder die dazu gehörige Literatur nicht leisten und waren deshalb auf Auszüge aller Art angewiesen.71 Dieses von den Autoren entsprechender Werke durchaus wahrgenommene Interesse geht zuweilen schon aus den Titeln oder den Eingangspassagen ihrer Texte hervor, wenn man etwa an den legistischen Liber pauperum des Vacarius (um 1115/20 bis um 1200) oder die Dekretabbreviatio Quoniam egestas denkt.72
Mitunter stand die so umrissene ökonomische Raison d’être auch in Verbindung mit anderen pragmatischen Faktoren. Das zeigt sich etwa im Prolog der um 1290 entstandenen Casus ad summam Henrici (Labia sacerdotis).73 In der Vorrede geht der Verfasser, vermutlich ein im deutschsprachigen Raum tätiger Franziskaner, u.a. auf die Ursprünge des Werks ein. Nachdem er wohl im Rahmen einer Vorlesung aus der Kirchenrechtssumme des Heinrich von Merseburg74 vorgetragen und dabei auch anschauliche Inhaltsangaben |(casus) zu Dekretalenkapiteln geboten hatte, die in der Summe fehlten, baten ihn seine Mitbrüder, diese Casus mit »kurzen und einfachen Worten (schriftlich) zu erläutern, damit die einfachen Brüder, die weder sich selbst noch die, die ihnen beichten, durch den finsteren Wald des kanonischen Rechts zur Klarheit führen können, den betreffenden Casus auf den Grund gehen und so die Schwierigkeiten ihrer Beichtkinder beheben können«.75 Der Verfasser begann daraufhin mit der Arbeit und verfasste auf der Grundlage von Auszügen aus den Dekretalen, dem Decretum Gratiani sowie den Summen und Glossenapparaten namhafter Lehrer des Kirchenrechts seine Casus samt Erläuterungen.
Die Prologpassage ist aus verschiedenen Gründen von Interesse. Das gilt zunächst für die Bezugnahme auf den finsteren Wald des kanonischen Rechts. Der Gedanke findet sich schon im 12. Jahrhundert und erscheint daher auf den ersten Blick nicht sonderlich bemerkenswert.76 Doch stellte sich das Problem der silva für den Verfasser der Casus etwas anders dar, als man es aus Sicht des römischen Rechts oder der älteren Kanonistik erwarten könnte. Es ging ihm nicht um die Unübersichtlichkeit der kirchlichen Rechtsordnung schlechthin,77 sondern um einen besonderen Aspekt dieses Problems, der sich aus der Bemerkung über die fratres simplices erschließt. Bei diesen Mitbrüdern handelte es sich schwerlich um einfache oder einfältige Leute,78 eher schon um Vorlesungsbesucher, denen an leicht zugänglichem Wissen über schwierige und umfangreiche Rechtstexte gelegen war. Allerdings, und hier zeichnet sich ein Unterschied zu den bisher betrachteten kanonistischen Epitomen ab, war dieses Interesse nicht gelehrter oder akademischer Natur. Das Bedürfnis erklärte sich vielmehr aus der Tätigkeit der fratres, die als Beichtväter praxisrelevanter Kenntnisse im Kirchenrecht bedurften und deshalb den Autor baten, seine Casus ad summam Henrici abzufassen.
Ein solches Anliegen lag durchaus im Zug der Zeit. Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts findet sich eine zunehmende Anzahl kanonistischer Epitomen, die sich an Leser richten, die keine Fachleute sind, womöglich sogar außerhalb der gelehrten Welt stehen.79 Zu denken ist dabei vor allem an Angehörige des Säkularklerus oder an Mendikanten, die besonders zur Ausübung der Beichtjurisdiktion, d.h. für das sog. Forum internum, praktischer kirchenrechtlicher Grundkenntnisse bedurften.80 Erinnert sei hier nur an die Abbreviatio, die der Dominikaner Raymund von Peñafort, der Redaktor des Liber Extra, von diesem Gesetzbuch anfertigte, um seinen Ordensbrüdern mit Blick auf die Bußdisziplin einen Überblick über die wichtigsten Dekretalen an die Hand zu geben.81 Die mitunter als simplices82 angesprochenen Adressaten solcher Werke verweisen auf den heterogenen und bislang nur unzureichend erforschten Bereich der von Roderich von Stintzing (1825–1883) sog. populären Literatur des römischen und kanonischen Rechts,83 der in den letzten Jahren Gegenstand neuer Einordnungsbemü|hungen war und den man großenteils wohl dem Komplex der normativen pragmatischen Literatur (Thomas Duve) zuordnen kann.84
Zu dem Kreis solcher eher praxisorientierter Schriften gehören nicht zuletzt die Beichtsummen oder Summae confessorum, die oft aus Auszügen aus anderen kanonistischen oder theologischen Werken bestehen.85 Sie waren gerade bei Theologen, die sich einen Überblick zum Kirchenrecht verschaffen wollten, beliebt.86 Eine solche Beichtsumme, die um 1462 verfasste Summa Angelica des Angelo Carletti (1410–1495) wurde in einzelnen Drucken des 16. Jahrhunderts mit so vielen additiones vor allem von Giacomo Ungarelli († 1517) versehen, dass man fast von einer Glossierung sprechen kann.87 Diese Verbindung von Exzerpierung bzw. Epitomierung und Glossierung, die sich bis zu den Abbreviationen des Decretum Gratiani zurückverfolgen lässt und sich auch noch in späteren Jahrhunderten findet, ist in doppelter Hinsicht von Interesse. Sie belegt zunächst das intellektuelle Potential, das dem Epitomierungsvorgang innewohnte. Der Epitomator verkürzte nicht nur Texte, er kondensierte dabei auch deren Inhalte. Doch kam es im Gefolge dieser gedanklichen Verdichtung mitunter zu einer Anlagerung von Texten,88 die auf ein bemerkenswertes Expansionspotential der Gattung hindeutet.
Die gerade angestellten Beobachtungen zu den Casus ad summam Henrici, den Beichtsummen sowie der Dynamik der Textentwicklung liefern bereits einige Hinweise, wo der Sitz im Leben der betreffenden, eher praxisorientierten Werke zu suchen ist. Er lag dort, wo Geistliche, die in der Seelsorge tätig waren, einer kirchenrechtlichen, im Zweifelsfalle ausbaufähigen Grundversorgung bedurften, die zugleich zentrale moraltheologische Fragen abdeckte und vielleicht noch einige Einsichten über das weltliche, näherhin das römische Recht vermittelte.
Eine solche Grundversorgung setzte eine wohldurchdachte Auswahl und Verarbeitung relevanter Materien und Textpassagen voraus. Von entsprechenden Bemühungen ist in verschiedenen Vorreden epitomierender Schriften des Spätmittelalters die Rede. So etwa in dem in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfassten Speculum abbreviatum des Johannes von Zinna (Stynna).89 Im Prolog geht der Verfasser u.a. auf den Zweck seiner Schrift ein. 90 Sie soll denjenigen, der sich mit der Wissenschaft vom kanonischen Recht beschäftigt, belehren und dem, der sich mit praktischen kirchenrechtlichen Fragen konfrontiert sieht, die Arbeit erleichtern. Es handelt sich also |um ein kanonistisches Lehrbuch und zugleich um eine praxisorientierte Anleitung insbesondere für den kirchlichen Prozess.91 Johannes beschreibt die Entstehung der Schrift mit Hilfe eines biblischen Exempels, das auch in anderen spätmittelalterlichen Nachschlagewerken (z.B. Summa Astensis) auftaucht:92 Wie die Moabiterin Ruth die Ähren hinter den Schnittern auflas (Rt 2,2–3), so folgte der Autor den Spuren der Gelehrten, und zwar insbesondere dem als Speculator geläufigen Wilhelmus Durantis, aus dessen Speculum iudiciale sich im Übrigen auch der Titel des Werkes erklärt.93 Das auf vielfältigen Auszügen aus fremden Schriften beruhende Speculum abbreviatum ist also als eine – in der Ausführung durchaus eigenständige – Epitome im weiteren Sinne anzusprechen.
Damit steht das Werk innerhalb der prozessualistischen Literatur des Spätmittelalters keineswegs allein. Erinnert sei hier nur an den aus dem frühen 15. Jahrhundert stammenden Processus iudicii des Kanonisten Johannes Urbach († nach 1422), dem schon Theodor Muther (1826–1878) mit Blick auf eine Edition gegenüber Johannes von Zinna den Vorzug gab.94 Das lag nicht nur daran, dass es sich bei Urbachs Processus um »das im 15. Jahrhundert in Deutschland am weitesten verbreitete gelehrtrechtliche Prozeßhandbuch« (Hartmut Boockmann) handelt.95 Vielmehr spielten auch mit dem Erfolg des Werkes in Zusammenhang stehende inhaltliche und kompositorische Gründe eine Rolle. Wie Johannes von Zinna, so griff auch Johannes Urbach auf Schriften anderer Autoren zurück, die er in seinem Werk in kondensierter Form verarbeitete. Das gilt abgesehen vom Speculum des Durantis insbesondere für die Schriften des Johannes Andreae, die wichtige Ergänzungen zum Werk des Speculator lieferten.96 Doch hatte Johannes Urbach nicht nur bei der Auswahl der Quellen, aus denen er schöpfte, eine glückliche Hand. Er verarbeitete das so gewonnene Material auch geschickt zu einer bündigen und übersichtlichen Darstellung.97 So stellte sich sein Werk im Vergleich zum Speculum abbreviatum nicht nur als eine deutliche Aktualisierung dar, sondern bot auch einen brauchbareren Einstieg in das weitschweifige Speculum des Durantis.98
Hier liegt ein wesentlicher Grund für den Anklang, den der Processus iudicii im 15. Jahrhundert fand. In einem Vortragstitel hat Knut Wolfgang Nörr diesen Erfolg einmal erklärt, indem er die literarische Form in Beziehung zu übergreifenden zeitgenössischen Rechtsentwicklungen setzt: »Zur Epitomisierung als einer Bedingung der Rezeption: das Beispiel der Prozeßschrift des Johannes Urbach«.99 Der Verweis auf die im Spätmittelalter verstärkt einsetzende Verbreitung des gelehrten Rechts nördlich der Alpen, die traditionell unter dem Begriff der Rezeption zusammengefasst wird,100 lenkt den Blick auf einen wichtigen Aspekt der Wirkungsgeschichte des Epitomierens, der schon für die ältere Forschung eine Rolle spielte. Er zeichnet sich etwas klarer ab, wenn man die bereits erwähnte 1867 von Roderich Stintzing veröffentlichte »Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts« betrachtet.101 Viele Werke, die in ihr auftauchen, sind als Epitomen im engeren oder weiteren Sinne anzusprechen.102 Für den Verfasser sind sie aufgrund seiner allgemeinen Fragestellung von Interesse, geht es ihm doch um die durch den Buch|druck weiteren Kreisen zugängliche, angeblich vor allem von Halbgelehrten oder Halbgebildeten benutzte, nicht im engeren Sinne wissenschaftliche Literatur, und zwar, wie der volle Buchtitel signalisiert, »in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts«. Stintzing interessierte sich für die entsprechenden Werke, die ihm eigentlich wenig sympathisch waren,103 weil ihr Einfluss in seinen Augen wesentlich zum Erfolg der Rezeption beitrug.
Vieles an Stintzings Buch hat seit dem 19. Jahrhundert zur Kritik herausgefordert, wenn man etwa an den Begriff der populären Literatur oder die Annahmen über die Benutzer der betreffenden Texte denkt.104 Ungeachtet seiner Schwächen ist eine dem Werk zugrunde liegende Überlegung durchaus plausibel und zwar, dass es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Literaturformen und der Verbreitung von Rechtskenntnissen gab. Dieser Gedanke lässt sich mit Blick auf das Epitomieren in mehrfacher Hinsicht weiterverfolgen und vertiefen. Das betrifft zunächst die bereits erwähnten ökonomischen Vorzüge epitomierender Bearbeitungen und die institutionellen bzw. pastoralen Hintergründe und Bedürfnisse ihrer Adressaten. Hinzu kommt ein in engem sachlichem Zusammenhang damit stehender anderer Aspekt, auf den soeben etwas näher eingegangen wurde. Emil Seckel hat ihn als entscheidende Leistung der sog. populären Literatur hervorgehoben und mit den Worten »Auswahl und Zurichtung des Stoffes« umschrieben.105
Beachtung verdient schließlich noch eine weitere Facette der Korrelation von Literaturform und Verbreitung von Rechtswissen, die im Folgenden etwas genauer betrachtet werden soll. Es ist die bei Stintzing in der Bezugnahme auf Deutschland anklingende räumliche Komponente. Mit ihr zeichnet sich ein Faktor ab, der nicht zuletzt die Wirkungsgeschichte der Epitomen im weiteren Sinne etwas stärker in den Blick rückt. So ließe sich etwa fragen, ob ein Zusammenhang bestand zwischen der Präsenz epitomierender Schriften und ihrer (verstärkten) Verbreitung in bestimmten Räumen, etwa nördlich der Alpen oder abseits der großen Zentren kanonistischer (bzw. legistischer) Gelehrsamkeit.
Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass sich der Wert entsprechender Werke für ihre Benutzer nicht zuletzt aus räumlichen Rahmenbedingungen ergab. Einige in diese Richtung deutende Hinweise werden schon im ersten Jahrtausend fassbar. So hob etwa im fünften Jahrhundert der Grammatiker Phocas zugunsten seines bündigen Lehrbuchs, welches gegenüber älteren Vorlagen deutliche Kürzungen brachte, hervor, dass der Reisende, der über dieses Werk verfüge, mit wenig Gewicht viel Gepäck mit sich führe.106 In eine ähnliche Richtung deutet eine Bemerkung in der aus dem 7. Jahrhundert stammenden titellosen Enzyklopädie des byzantinischen Arztes Paulos von Ägina, der sich entnehmen lässt, dass Anwälte über Florilegien verfügten, die auf Kapitelverzeichnissen von Gesetzen beruhten, dem schnellen Gebrauch dienten und auch als συνέκδημοι (»Reisebegleiter«) bezeichnet wurden.107 Auch wenn Paulos hervorhebt, dass Advokaten fast nur in Städten tätig sind, wo Bücher reichlich zur Verfügung stehen, wird hier doch eine Verwendung von Abrissen erkennbar, die im späteren Mittelalter in lateinischen Buchtiteln wie vade mecum oder veni mecum eine Entsprechung findet.108 Im Hintergrund steht im einen wie im anderen Fall der Gedanke eines in Kompendien verdichteten (Rechts-)Wissens, das man materialiter leicht mit sich führen konnte. Ein solches Vademecum war, wie schon Paulos mit Blick auf die Ärzte (und seine eigene Epitome) betont, für denjenigen, der außerhalb der Städte und hohen Schulen tätig war, von besonderem Wert.
Geht man vom frühen zum hohen Mittelalter über, dann deuten auch die bereits erwähnten dekretistischen Abbreviationen auf die Bedeutung der räumlichen Komponente hin. Beyers Dissertation über drei Werke dieser Gattung führt nicht nur die regionalen Entstehungshintergründe der |untersuchten Texte vor Augen.109 Sie bestätigt auch ältere Vermutungen, denen zufolge Abbreviationes des Decretum Gratiani außerhalb Bolognas, ja Italiens, wo man sich noch vergleichsweise leicht Textkenntnisse des Dekrets verschaffen konnte, entstanden und dadurch zugleich einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Decretum in Europa leisteten.110 In eine ähnliche Richtung deuten übrigens auch die schon betrachteten Casus ad summam Henrici, denn es ist sicher kein Zufall, dass das betreffende Werk nicht an einer Universität in Italien oder Frankreich entstanden ist, sondern nördlich der Alpen im Umkreis franziskanischer Gelehrsamkeit. Offensichtlich war das Bedürfnis nach einer kirchenrechtlichen Grundversorgung, d.h. den Informationen, die sie boten, nicht überall in gleichem Maße ausgeprägt.
Worin könnte nun im Spätmittelalter die besondere Attraktivität von Epitomen mit Blick auf räumliche und rechtlich-kulturelle Rahmenbedingungen konkret bestanden haben? Die Frage führt noch einmal zurück zum Speculum abbreviatum. Jenseits der allegorischen Selbstdeutung beleuchtet sein Prolog durchaus den Entstehungshintergrund und Zweck des Werkes. In der Vorrede erwähnt nämlich der Verfasser, dass er seine Schrift für den eigenen Gebrauch angefertigt hat, und zwar wenn er sich im Rahmen seiner Tätigkeit für das Kloster Kolbatz und den Zisterzienserorden an entlegenen Orten aufhielt, wo umfangreiche Werke wie das Speculum des Durantis oder Formelsammlungen nicht zur Verfügung standen. Das Speculum abbreviatum bot dann gleichsam eine kanonistische Wegzehrung (viaticum). Es handelte sich also in gewisser Weise um eine stark komprimierte kirchenrechtliche Reisebibliothek, die Johannes von Zinna leicht mit sich führen konnte. Hier zeichnet sich zugleich eine (gedachte) Gebrauchssituation ab. Das Werk sollte dem canonista in itinere, der andere kirchenrechtliche Werke gerade nicht zur Hand hat, als Hilfsmittel dienen.111
Damit ist ein Bedürfnis umrissen, dem auch in anderen Epitomen aus dem Umkreis des gelehrten Rechts Rechnung getragen wird. So heißt es etwa im Breviarium super Codice des Legisten Johannes Faber (Jean Faure) († um 1340), die Schwäche des Gedächtnisses, die Menge der Meinungen, die beinahe unendliche Zahl der Bücher, die man nicht überallhin mitnehmen und einsehen könne: All das habe ihn, der oft in Geschäften unterwegs sei, dazu bewogen, die Zusammenfassungen der Glossen und die Ausführungen der Rechtsgelehrten in seinem Büchlein auszulassen, das zusammen mit dem Codex Justinianus leicht in einer Satteltasche mitgeführt werden könne.112 Die Bezeichnung Breviarium erkläre sich daher, dass der vorliegende Abriss kurz gehalten, für einen und von einem Reisenden und in Geschäften Tätigen verfasst und weitgehend ohne Zugriff auf Bücher entstanden sei.113
Die Aussage zum Entstehungshintergrund und zu den Adressaten des Werkes lässt deutliche Gemeinsamkeiten mit dem Speculum abbreviatum erkennen. Ähnliche Bemerkungen finden sich auch in späterer Zeit, etwa in dem ca. 1478 verfassten Viatorium des Johannes Berberius (Jean Bardier, † nach 1515).114 Der Titel ist, wie der im Languedoc beheimatete Verfasser zu erkennen gibt, Programm: viatorium intitulaui tanquam per viam et viando portabile.115 Johannes wollte, wie er zu |Beginn seiner Schrift hervorhebt, einen kleinen und tragbaren Band verfassen, den Reisende und besonders Advokaten und Konsulenten bei Gericht (consiliarii curiarum), die oft durch die Provinz reisen, benutzen können, um in praktischen Fragen ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.116 Deshalb beschränkt sich der Verfasser darauf, nur den Legaltext, die Glosse und die Entscheidungsgründe zu allegieren, obwohl er, wie er versichert, mit den Auffassungen der alten wie der neuen doctores iuris utriusque vertraut ist.
Ein Vergleich mit der entsprechenden Passage im Breviarium des Johannes Faber lässt neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede erkennen. Das gilt insbesondere für die Berücksichtigung juristischer Literatur. Berberius erscheint in diesem Punkt eher pragmatisch und konservativ, während sich das fast anderthalb Jahrhunderte ältere Werk des Johannes Faber durch eine radikalere Haltung auszeichnet. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Behauptung, das Breviarium sei großenteils ohne Zugriff auf Bücher (extra librorum presentiam) entstanden,117 nicht ganz so klar ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Möglicherweise handelt es sich hier nicht zuletzt um eine programmatische Aussage, denn der Autor zeigt sich nicht nur in diesem Werk, sondern auch in seinem Institutionenkommentar skeptisch, was den Wert großer Teile der juristischen Literatur angeht.118 Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Verbindung von »Literaturkritik« und einem praktischen Interesse an einem verschlankten Text, die im Breviarium des Johannes Faber fassbar wird.
Diese Kombination erscheint für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zunächst außergewöhnlich. Ein Blick auf frühere und spätere Entwicklungen vermittelt jedoch den Eindruck, dass eine solche Haltung gewisse Vorläufer hatte und sich als durchaus zukunftsträchtig erweisen mochte. Das ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass die Vorbehalte gegenüber bestimmten Formen juristischer Literatur bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen und gegen Ende des Mittelalters verstärkt geäußert wurden.119 Zum anderen kam den seit dem Hochmittelalter geläufigen Argumenten für schlanke verdichtete Texte gerade im Zeitalter des Buchdrucks noch stärkere Bedeutung zu. Das zeigt sich etwa, wenn man den Prolog der Summa Astensis, einer weitverbreiteten, um 1317 verfassten Beichtsumme mit den Buchanzeigen vergleicht, in denen der Straßburger Drucker Johann Mentelin für seine drei Astensis-Drucke der späten 1460er und frühen 1470er Jahre wirbt.120 Abgesehen von wirtschaftlichen und mnemotischen Gesichtspunkten wird vor allem die Eigenschaft der Summe als Auszug und Auswahl aus anderen Gelehrtenschriften hervorgehoben. Während sich der Verfasser der Summa Astensis noch genötigt sah, dieses Charakteristikum im Prolog mit Hilfe eines biblischen Bescheidenheitstopos (Exempel der Ruth) zu rechtfertigen, erscheint es in den Buchanzeigen als entscheidendes Qualitätsmerkmal des Werkes.
Ein anderer interessanter Beleg, wie sich unter den Vorzeichen des Buchdrucks das Interesse an reduziertem Text mit der Kritik an überkommenen Literaturformen verbinden konnte, findet sich |im Kolophon eines 1519 in Rouen gedruckten Liber Extra, der keine Glosse aufweist und Oktavformat hat.121 In der Schlussformel wird die Ausgabe besonders angepriesen: Über Land Reisenden stehe mit dem kompakten Band der größte und glänzendere Teil des kanonischen Rechts befreit von der Last der Glosse zur Verfügung. Wohin man auch gehe, er passe in jeden Bücherkasten, ja beinahe in jeden Geldbeutel. Die Reisenden sollten sich dabei an das Wort jenes princeps juristarum ac practicorum Johannes Faber erinnern, den die angehäufte Menge der Glossen (glosarum congeries) mit heftigem Schaudern erfüllte: Durch richtig verstandene Texte hat man alles.
Die Liber Extra-Ausgabe von 1519 wurde von Pierre Olivier in Rouen auf Kosten des Pariser Buchhändlers François Regnault († um 1540) hergestellt und war Teil einer kleinformatigen Ausgabe des Corpus Juris Canonici ohne Glosse, die von Regnault 1519 veranstaltet wurde. Ein Jahr zuvor hatte derselbe Buchhändler bereits eine unglossierte, von Gilles d’Aurigny († 1553) herausgegebene Ausgabe des Corpus Juris Civilis (ohne die Institutionen) auf den Markt gebracht.122 In einem zu Beginn des Digestum vetus-Bandes abgedruckten Brief d’Aurignys an Regnault geht der Verfasser auf das Zustandekommen dieser Ausgabe ein, nimmt für das Vorhaben Johannes Faber in Anspruch und verschärft dessen im Institutionenkommentar geäußerte Vorbehalte gegenüber manchen Spielarten der juristischen Literatur zu einer weitergehenden (humanistischen) Kritik an der angeblich chaotischen Glosse.123 Die Parallelen zwischen Brief und Liber Extra-Kolophon sind augenfällig.124 Ganz gleich, wer die Schlussformel verfasst hat, sie liefert gleichsam in verdichteter Form bereits aus dem Digestum vetus-Brief bekannte Verkaufsargumente für eine unglossierte Ausgabe.
Unabhängig von anderen Schnittpunkten zwischen Regnaults Aktivitäten und dem Interesse an kanonistischen Epitomen – zu denken wäre etwa an den Druck von Johannes Fabers Breviarium (1516) oder von Johannes Kölner de Vanckels (1448–1490) Breviarium Sexti et Clementinarum (1513)125 – beleuchtet das hier betrachtete Liber Extra-Kolophon gleichsam aus nachmittelalterlicher Perspektive noch einmal einen besonderen Aspekt des weiter zurückreichenden grundsätzlichen Interesses an verschlankten und kondensierten Texten. Die betreffende Ausgabe gilt als früher Beleg für eine (Druck-)Tradition praktischer »Taschenbücher«, die besonders den Bedürfnissen der Provinz entgegenkamen.126 Auch wenn man die tatsächliche Nachfrage nach kleinformatigen, unglossierten Gesetzestexten für das frühe 16. Jahrhundert nicht überschätzen darf, so sind doch ihre Vorzüge gerade unter den in der Schlussformel hervorgehobenen räumlichen Vorzeichen unverkennbar. Solche räumlichen Aspekte finden sich im Kern bereits in den Überlegungen eines Johannes Faber, Johannes Urbach, Johannes von Zinna und Johannes Berberius. Epitomierende Darstellungen eröffneten gerade demjenigen, der auf Reisen oder abseits der Zentren tätig war und keine Bibliothek zur Verfügung hatte, Zugang zu Kernbeständen gelehrten Rechtswissens. Dadurch waren sie ein entscheidender Faktor für die Mobilisierung und insbesondere räumliche Verbreitung von Rechtswissen. Hier schließt sich der Kreis zu den zuvor betrachteten Literaturfor|men.127 Die Bedeutung eines auf Auszügen gestützten Transfers gelehrten Rechtswissens zeigt sich, gerade wenn man an den Erfolg der Literatur zum Forum internum128 oder mancher prozessualistischer Schriften denkt, nicht zuletzt im spätmittelalterlichen Regnum Teutonicum. Demgegenüber verweist Regnaults Ausgabe auf weitergehende Mobilisierungsprozesse, die im Zeitalter des Buchdrucks und der großen Entdeckungen über einzelne Regionen und Länder, ja Europa hinausgingen. Erinnert sei hier nur an die Bedeutung kondensierter Texte in der pragmatischen normativen Literatur des frühneuzeitlichen Iberoamerika.129
Fragt man abschließend nach der Rolle, die das Epitomieren und die daraus erwachsenden Literaturformen in der Neuzeit spielten, dann ist zunächst festzuhalten, dass beides in der Wissenschaft und Literatur des katholischen Kirchenrechts durchaus präsent war. Allerdings kam es im Vergleich zum Spätmittelalter zu einer weiteren Verschiebung der Gewichte. Auszüge aus den großen, seit etwa 1500 im Corpus Juris Canonici zusammengefassten Rechtssammlungen (Decretum Gratiani, Liber Extra, Liber Sextus, Clementinen) finden sich kaum noch.130 Dafür stößt man auf sog. Konzilssummen oder Summae conciliorum (z.B. des Bartolomé Carranza y Miranda),131 auf Auszüge aus den großen Bullarien und gelegentlich auch auf epitomierte Ordensregeln.132 Ferner fällt auf, dass manche Werke, deren Titel eine Epitome der Rechtsquellen in Aussicht stellt, kaum mehr als Register oder Repertorien sind.133
Große Bedeutung kam dem Epitomieren dagegen weiterhin mit Blick auf die kanonistische Literatur zu. Wie in der zeitgenössischen katholischen Moraltheologie, so finden sich auch in der Kanonistik epitomierende Bearbeitungen umfangreicherer Vorlagen, wenngleich in bescheidenerem Umfang.134 Manche Ausgangstexte wurden von den Verfassern selbst zu solchen Kompendien kondensiert.135 Daneben stößt man aber auch auf Literaturgattungen wie die kanonistischen Paratitla, die in ihrem Zugriff auf die Rechtsquellen und die dazugehörige Literatur deutliche Berührungspunkte mit den Epitomen (im weiteren Sinne) erkennen lassen.136 Zudem finden sich in manchen größeren Sammlungen theologischer und kanonistischer Literatur wie z.B. in Juan Tomás de Rocabertis (1627–1699) Bibliotheca maxima pon|tificia oder in Francesco Antonio Zaccarias (1714–1795) Thesaurus theologicus Werke, die nur in Auszügen abgedruckt und insofern als Epitomen anzusprechen sind.137
Dass das Epitomieren in der frühneuzeitlichen Kanonistik auf vielfältige Weise präsent war, heißt nicht, dass die Arbeitstechnik und die dazugehörigen Genera auch allseits geschätzt wurden. Während die sich im Spätmittelalter verschiedentlich artikulierenden Bedenken hinsichtlich der steigenden Flut an gelehrter Literatur zunächst einmal eher für als gegen Auszüge sprachen, führte der Einfluss des Humanismus, der dieser Skepsis teilweise schon zugrunde lag, im Laufe der Zeit wohl auch zu einer veränderten Haltung in Hinblick auf die Epitomen.138 Gerade im Zusammenhang mit dem akademischen Unterricht wurde ihre Rolle mitunter kritisch beurteilt. So findet sich etwa in den Pariser Universitätsstatuten von 1598 mit Blick auf die kanonistische Fakultät eine Bestimmung, wonach nicht anhand von Epitomen unterrichtet werden durfte, vermutlich weil man sicherstellen wollte, dass die Studenten den Legaltext selbst (in vollem Umfang) lasen und sich nicht auf Auszüge verließen.139 Zudem wird in der propädeutisch-didaktischen Literatur von namhaften Kanonisten (z.B. François Florent und Jean Doujat) und Theologen (z.B. Martin Gerbert) vor der Benutzung von Epitomen gewarnt.140
Es ist wohl kein Zufall, dass solche kritischen Stimmen im Laufe des 18. Jahrhunderts seltener wurden und schließlich ganz verstummten. Epitomieren und Epitomen setzen Textmassen voraus, die es zu bewältigen gilt. Doch schrumpften diese in der Kanonistik im 18. Jahrhundert rasant zusammen. Das zeigen die Buchformate. Waren zu Beginn des Jahrhunderts noch Folio und Quart vorherrschend, so waren es am Ende Oktav und Duodez. Dem zugrunde lagen weitreichende institutionelle und methodische Veränderungen. Viele Bestimmungen des kanonischen Rechts waren schon lange vor (und erst recht nach) dem Ende des Ancien Régime toter Buchstabe, so dass sich eine eingehende Beschäftigung mit dem überkommenen, einst intensiv kommentierten Normenbestand oft erübrigte. Hinzu kamen methodische Neuansätze, in deren Gefolge an die Stelle scholastischer Textarbeit eher rationalisierende bzw. deduzierende Darstellungsformen traten.141
Den überkommenen kanonistischen Epitomen, die langatmige gelehrte Diskussionen auf das Wesentliche zurechtstutzten, war damit die Grundlage entzogen. Hinzu kamen neue Vorstellungen von Autorschaft und Originalität, welche die Epitomierung fremder Werke zunehmend bedenklich, wenn nicht gar unzulässig erscheinen ließen. Allerdings findet sich auch in der Kanonistik des 19. und 20. Jahrhunderts das Phänomen, dass ein Autor sein umfangreiches Handbuch zu einem kürzeren Lehrbuch kondensiert. Zudem stößt man bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in der Kirchenrechtswissenschaft und Moraltheologie auf Werke, die sich ausweislich ihrer Titel als Epitomen zu erkennen geben.142 Tatsächlich handelt es sich dabei zumeist jedoch um etwas anderes, was sich vielleicht am besten als ein auf ausgewählten Materialien beruhender Abriss des Kirchenrechts oder der Moraltheologie umschreiben ließe. Spätestens mit der ersten Kodifikation des kanonischen Rechts der lateinischen katholischen Kirche, d.h. dem Codex Iuris Canonici von 1917, war die Zeit der klassischen Epitomen endgültig vorbei. Nun waren die Verbindungslinien nicht nur zum Corpus Juris Canonici, sondern auch zu der älteren |kirchenrechtlichen Literatur gekappt. Die Welt der vormodernen kanonistischen Textkultur, in der das Epitomieren einen festen Platz hatte, war für immer versunken.
Abgesehen von den gerade behandelten, in fortlaufender Rede abgefassten Werken setzte sich die Tradition des Epitomierens noch auf andere Weise bis in die Moderne fort. Auf diesen besonderen Aspekt sei anhand eines Beispiels abschließend noch hingewiesen. In den Jahren 1785–1789 veröffentlichte Giovanni Devoti (1744–1822) ein Lehrbuch der Institutionen des kanonischen Rechts in vier Bänden, das als eines von wenigen Werken der Kanonistik des späten Ancien Régime im 19. Jahrhundert eine Reihe von Auflagen erlebte.143 1835, mehr als ein Jahrzehnt nach Devotis Tod, wurde der später ebenfalls bekannte Kirchenrechtler Camillo Tarquini (1810–1874) in Rom mit einer ungewöhnlichen, noch in demselben Jahr anonym veröffentlichten Dissertation zum Doktor des kanonischen Rechts promoviert.144 Er hatte Devotis Lehrbuch unter Aufgabe eines fortlaufenden Textes in schematisch-tabellarische Darstellungen (tabulae) verwandelt (siehe Abb. 1).
Ein solches Interesse an graphischen Darstellungsformen war an und für sich nicht neu. Seit dem 11. Jahrhundert finden sich in legistischen und kanonistischen Handschriften sog. schematische Distinktionen, durch die bestimmte in einer Gesetzesstelle oder auctoritas enthaltene Begriffe oder Regeln z.B. in Gestalt von Marginalglossen veranschaulicht werden.145 Auf vergleichbare Darstellungen stößt man in theologischen Werken spätestens seit dem 12. Jahrhundert.146 Mit der Erfindung des Buchdrucks ließen sich tabellarische Darstellungen leichter und kostengünstiger herstellen.147 Dementsprechend finden sich seit dem 16. Jahrhundert neben dem Regelfall, d.h. in fortlaufendem Text verfassten Werken, in der Kanonistik und Moraltheologie auch tabulae, die teilweise mit Kommentaren des Autors versehen sind.148 Diese nicht zuletzt didaktisch motivierte Darstellungstradition lässt sich gerade in der Theologie bis in das 20. Jahrhundert verfolgen.149
Doch zurück zu Tarquinis Werk, das interessante Resonanz fand. Es erlebte nicht nur
fünf Jahre nach seinem Erscheinen eine zweite, unveränderte Auflage,150 sondern war auch Gegenstand einer kommentierten Neuausgabe durch Jean-François-Marie
Lequeux (1796–1866).151 Das ist insofern bemerkenswert, als dieser Kanonist nicht wie Devoti und Tarquini
zum Kreis der kurialen Autoren gezählt werden kann. Vielmehr war er ein später Vertreter
des Gallikanismus.152 Dass er sich |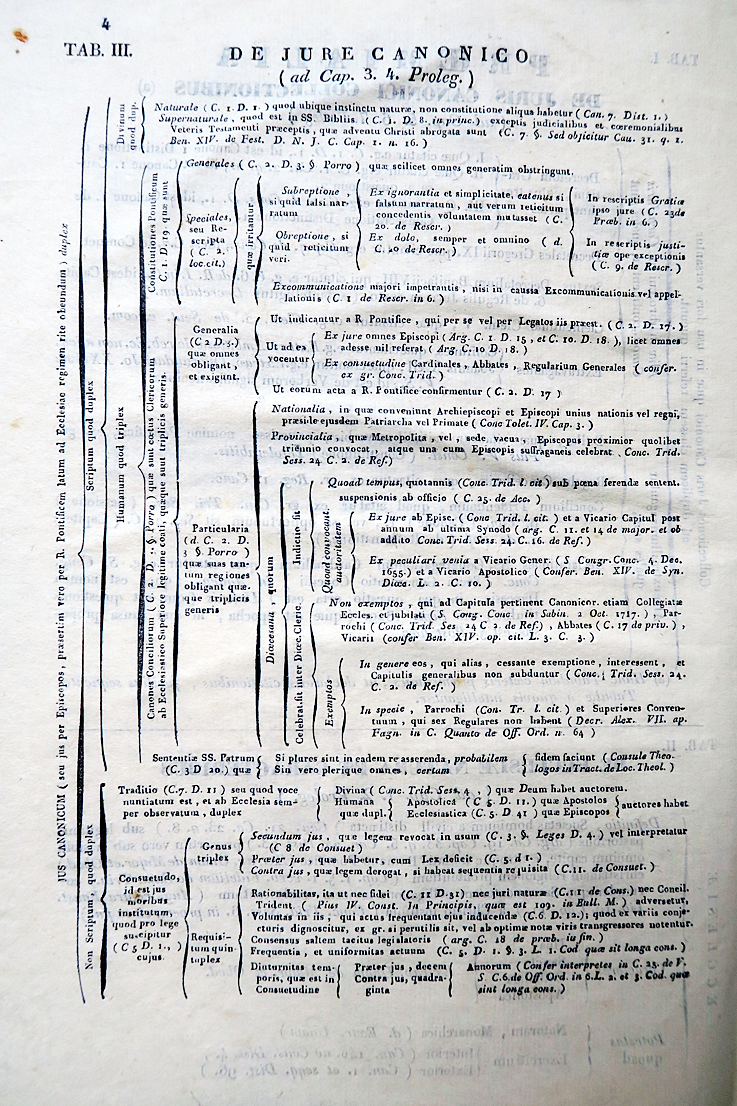
Lequeuxs Interesse an den tabulae wird erst wirklich verständlich, wenn man sich den didaktischen Wert, den er ihnen beimaß, vor Augen hält. Dieser ist Lequeux zufolge für Fortgeschrittene noch höher anzusetzen als für Anfänger.157 Das führt zu der Frage, worin das Besondere der Vorlage besteht. Bemerkenswert an Tarquinis Werk ist vor allem dreierlei: Zunächst setzt der Verfasser, wenngleich er zahlreiche Allegationen liefert, nicht bei den Quellen selbst, sondern bei der Literatur an. Weiterhin arbeitete Tarquini nicht eklektisch, sondern machte Devotis Lehrbuch zum Gegenstand einer graphisch-tabellarischen Epitomierung. Drittens schließlich stellt sich das Werk ausweislich eines vorangestellten Zitats als von theoretischen Überlegungen des protestantischen Philosophen und Juristen Christian Wolff (1679–1754) inspiriert dar, der sich bereits ein Jahrhundert zuvor mit der Herstellung und dem Gebrauch mnemonischer Tafeln beschäftigt hatte.158
Der Rückgriff auf die Mnemotechnik, mit deren Hilfe kirchenrechtliche Begriffsraster dem Leser dauerhaft vermittelt werden sollten,159 berührt eine Seite des Epitomierens, die zu allgemeineren Fragen über das Verhältnis von Text und begrifflichem Inhalt Anlass gibt. Wenn die bis ins 18. Jahrhundert in der Kanonistik vorherrschende scholastische Methodik letztlich auf einem »Denken am Text« beruhte,160 dann scheint sich daraus auch die besondere Wirkungsweise des Epitomierens zu ergeben. Entscheidend war demnach die Arbeit am Text, in deren Folge es gegebenenfalls zu einer Umgestaltung der Rechtsbegriffe kam.
Angesichts der Tatsache, dass Tarquinis Tabulae synopticae in einer langen Tradition schematisch-tabellarischer Darstellungen stehen, die bis weit in das Mittelalter zurückreicht, könnte man sich allerdings fragen, ob das Epitomieren nicht noch eine andere produktive Seite hatte. Diese tritt womöglich etwas klarer hervor, wenn man berücksichtigt, dass die silva legum nicht nur in einem Wald der Gesetzestexte, sondern auch in einem Dickicht der rechtlichen Begriffe und Regeln bestand. Wenn nun ein Epitomator ausweislich seiner schematischen Darstellungen eine klare Vorstellung von der Ordnung der Rechtsbegriffe und -regeln hatte, war dann nicht seine Epitome mehr als nur eine durch das Holz der Rechtstexte geschlagene Schneise? Die Frage führt noch einmal zurück zu den bereits früher angesprochenen möglichen Abstraktionsleistungen des Epitomierens. Für das frühe Mittelalter wird man, wie schon angedeutet,161 hier eher Zweifel hegen müssen. Anders stellt sich das Bild möglicherweise für das zweite Jahrtausend im Allgemeinen und die Neuzeit im Besonderen dar. Hier läge wohl eine lohnende Fragestellung für weitere Forschungen, etwa wenn man an die Bedeutung von epitomierenden Darstellungen für die Normgebung denkt.162
|Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina) (1900), hg. v. Patetta, Federico (Bullettino dell’Istituto di diritto romano, Bd. 12), Rom
Alanus de Insulis (1855), Liber in distinctionibus dictionum theologicalium, in: Migne, Jaques-Paul (Hg.), Patrologiae cursus completus […] (Series latina, Bd. 210), Paris, Sp. 685–1012
[Anon.] (1930), Rerum canonicarum scriptores. Tabulae synopticae ab anno 1141 ad annum 1564, in: Jus pontificium 10, 83–92
Archives legislatives de la ville de Reims (1847), hg. v. Varin, Pierre, Bd. 2,1, Paris
[Astesanus de Astis] (1519), Summa Astensis, Lyon
Bacon, Francis (1858), De augmentis scientiarum, in: Spedding, James et al. (Hg.), The Works of Francis Bacon, Bd. 1, London, 415–837
Becker, Clemens (1772), Compendium juris decretalium ex ipsis decretalibus collectum, […], Münster
Becker, Clemens (1781), Decretum Gratiani abbreviatum […], Münster
Berthier, Joachim Joseph (1931), Tabulae systematicae et synopticae totius Summae theologicae juxta ipsammet Doctoris Angelici methodum strictius et clarius exactae, Paris
Bibliotheca maxima pontificia (1695–1699), in qua authores melioris notae qui hactenus pro Sancta Romana Sede, tum Theologice, tum Canonice scripserunt, fere omnes continentur, hg. v. Rocaberti, Juan Tomás de, 20 Bde., Rom
Brancatus, Laurentius (1659), Epitome canonum omnium […], Rom
Buddeus, Johannes Franciscus (1721), Institutiones theologiae moralis in tabulis synopticis repraesentatas, in gratiam theologiae studiosorum, ut totum theologiae moralis ambitum, in mappa quasi delineatum, uno conspectu intueri possint, evulgare, ac omnibus doctrinam in compendio amantibus consecrare voluit Joh. Anton Strubberg, Jena
Canciani, Paulus (1781), Praefatio Collectoris, in: ders. (Hg.), Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis, Bd. 1, Venedig, IX–XX
Canus, Melchior (1563), De locis theologicis libri duodecim, Salamanca
Cappelli, Aloysius (1819), Manuale juris canonici quod in usum auditorum quinquaginta tabulis synopticis delineavit et brevibus notis illustravit, Vilnius
[Casaubon, Isaac] (1709), Henrico IV. Franciae et Navarrae Regi Christianissimo, Isaacus Casaubonus S.D., in: Almeloveen, Theodoro Janson ab (Hg.), Isaaci Casauboni epistolae, insertis ad easdem responsionibus […], Rotterdam, 54–89
Codex Iustinianus (1970), hg. v. Krüger, Paul (Corpus Iuris Civilis, Bd. 2), 15. Aufl., Dublin
Compendium textuale compilationis decretalium Gregorii noni sine qua (vt est vulgaris prudentum sententiam) omnis ceca practica est (1519), Paris
de Lesclache, Louis (1675), La Philosophie en tables, divisée en cinq parties […], Marseille
de Rives, Gregorius (1663), Epitome canonum conciliorum in locos communes per alphabetum digesta […], Lyon
Devoti, Joannis (1785–1789), Institutionum canonicarum libri IV, 4 Bde., Rom
Digesti veteris cum fertilibus legum summarijs aurea promulgatio (1518), Paris
Doujat, Joannes (1717), Praenotionum canonicarum libri quinque: quibus sacri juris atque universi studi ecclesiastici principia enucleantur, Venedig
Étienne de Tournai (1893), Lettres, hg. v. Desilve, Jules, Valenciennes
Ferreres, Juan B. (1933), Epitome theologiae moralis Codicis Canonici praescriptionibus, ac subsequentibus Sanctae Sedis declarationibus, dispositionibus iuris Hispani ac Lusitani, decretis Concilii Plenarii Americae Latinae necnon I Conc. Prov. Manilani earundemque regionum legibus peculiaribus etiam civilibus accomodata, 4. Aufl., Barcelona
Florens, Franciscus (1679), Oratio in aperiendis scholis iuris habita VI. Non. Octob. anno M.DC.XXXII. ad IX. tractatum calcem edita anno 1641. De recta iuris canonici discendi ratione, in: ders., Opera juridica, Bd. 1, Paris, 59–63
Foca (1974), De nomine et verbo, hg. v. Casaceli, F. (Collana di studi classici, Bd. 16), Neapel
Gerbert, Martinus (1754), Apparatus ad eruditionem theologicam, institutioni tironum Congregationis S. Blasii O.S.B. in silva nigra destinatus, Augsburg
Girardus, Iacobus (1551), Tituli totius iuris caesarei et pontificii per tabulas, iuxta literarum ordinem, seiunctim digesti […], Lyon
Goritia, Franciscus Antonius a (1796), Epitome theologiae canonico-moralis omnes seorsim in bis centis triginta tribus tabulis clare distincte ac breviter materias practicas exhibens, confessariorum, examinatorum, necnon examinandorum usibus accommodata, Rom
Gregorius Magnus (1979), Moralia in Iob, libri I–X, hg. v. Adriaen, Marc (Corpus Christianorum, Series latina, Bd. 143), Turnhout
Grosseteste, Robert (1984), Templum Dei, edited from Ms. 27 of Emmanuel College, Cambridge, hg. v. Goering, Joseph, Frank A. C. Mantello (Toronto Medieval Latin Texts, Bd. 14), Toronto
Haemstedius, Hadrianus Cornelius (1552), Tabulae totius sacrosancti iuris canonici, Löwen
|[Hieronymus] (1982), Epistula Hieronymi adversus Rufinum presbyterum, in: Lardet, Pierre (Hg.), S. Hieronymi presbyteri opera, Pars III: Opera polemica, Bd. 1 (Corpus Christianorum, Series latina, Bd. 79), Turnhout, 73–116
[Johannes Berberius] (1536), Viatorium seu directorium iuris: ex visceribus et medullis iuris vtriusque excerptum non sine magno labore et singulari industria egregii viri iurisque peritissimi do. Ioannis Berberii feliciter incipit, Lyon
Johannes de Vanquel Coloniensis (1513), Breuiarium sexti et clementinarum, Paris
[Johannes Faber] (1516), Aureum domini Johannis Fabri natione Galli vtriusque censure doctoris famatissimi ac expetende breuitatis Fabricatoris in Justinianum codicem Breuiarium multis elucubratum ac castigatum vigiliis. […] Cum Torturarum ac questionum insigni repetitione Necnon de Insigniis et Armis Bartholi tractatu exquisitissimo Feliciter incipit, Paris
[Johannes Faber] (1557), Ioannis Fabri I. V. D. In Institutiones commentarii autographo collati, Lyon
Johannes Urbach (1873), Processus iudicii qui Panormitani ordo iudiciarius a multis dicitur, hg. v. Muther, Theodor, Halle
[Johannes von Zinna] (1511), Speculator abbreuiatus. Alias Speculum abbreuiatum Joannis de Stynna cum variis libellorum et instrumentorum tam in iudiciis quam in contractibus occurentium: aliorum quam ad practicam vtriusque iuris mirifice deseruientium formis: opus insigni raritate carum, [Straßburg?]
Kurtz, Hermannus (1761/62/64), Amussis canonica titulorum libri I–V tabulis mnemonicis analytice proposita […], Prag
Lancellottus, Ioannes Paulus (1583), Institutiones iuris canonici quibus ius pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur, Rom
Legis Romanae Wisigothorum fragmenta (1896), Ex codice palimpsesto sanctae Legionensis ecclesiae protulit, illustravit, ac sumptu public edidit Regia Historiae Academia Hispana, Madrid
Le Masson, Innocentius (1662), Theologia practica per tabulas distincta et exposita, Paris
Lequeux, Jean-François-Marie (1843/44), Manuale compendium juris canonici ad usum seminariorum, juxta temporum circumstantias accomodatum, 4 Bde., 2. Aufl., Paris
[Lequeux, Jean-François-Marie] (1845), Synopsis juris canonici communis secundum ordinem institutionum J. Devoti per tabulas disposita. Opusculum e selectissimis doctorum utriusque juris operibus collectum. In hac Parisiensi editione indicantur praecipua disciplinae gallicanae a jure communi discrimina per opportunas remissiones ad Manuale compendium juris canonici D. Lequeux majoris seminarii Suessionensis moderatoris, Paris
Lex Romana Visigothorum (1849), hg. v. Hänel, Gustav, Leipzig (ND: Aalen 1962)
[Luther, Martin] (1919), D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 5: Tischreden aus den Jahren 1540–1544, hg. v. der Kommission zur Herausgabe der Werke Martin Luthers, Weimar
Manassero, Bartholomaeus (1903–1907), Tabulae synopticae theologiae moralis e probatis auctoribus desumptae, 4 Bde., 2. Aufl., Rom
Mansi, Joannes Dominicus (1763), Epitome doctrinae moralis, et canonicae ex constitutionibus aliisque operibus felicis recordationis Benedicti XIV. pontificis maximi, Rom
Maranta, Carolus (1656), Medulla Decreti alphabeticis distinctis litteris in qua quicquid in Decreto continetur per propositiones distinctas producitur; atque ex sanctorum patrum et conciliorum verbis fundatur; necnon aliquoties doctorum atque etiam sacrorum theologorum auctoritate fulcitur […], Neapel
Monnier, G.-F. (1857), Atlas de la doctrine catholique ou cours complet de religion en tableaux synoptiques comprenant le dogme, la morale, les moyens de salut & la liturgie. Ouvrage utile aux Ecclésiastiques, aux Séminaristes et à tous ceux qui veulent faire de la Doctrine chrétienne une étude approfondie, Lyon
Olearius, Johannes (1694), Doctrina theologiae moralis totius, in usum incipientium, certis paediae ac methodi limitibus circumscripta et tabulis LXXII. comprehensa, Leipzig
Pacius a Beriga, Iulius (1616), Oeconomia iuris utriusque, tam civilis, quam canonici, perspicuis tabulis ad memoriam iuvandam repraesentata, et annotationibus illustrata, Lyon
Paulus Aegineta (1921), [ohne Titel], in: Heiberg, Jahan L. (Hg.), Corpus medicorum Graecorum, Bd. 9,1, Leipzig
Petrus Blesensis (1855), Epistolae, in: Migne, Jaques-Paul (Hg.), Patrologiae cursus completus […] (Series latina, Bd. 207), Paris, Sp. 1–560
Petrus Lombardus (1971), Sententiae in IV libris distinctae. Editio tertia ad fidem codicum antiquorum restituta, Bd. 1,2: Liber I et II (Spicilegium Bonaventurianum, Bd. 4), Grottaferrata
Pichler, Vitus (1716–1721), Candidatus jurisprudentiae sacrae, seu juris canonici secundum Gregorii Papae IX. decretalium titulos explanati […], 5 Bde., Augsburg
Pichler, Vitus (1731), Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae. Hoc est, juris canonici secundum Gregorii Papae IX. libros V. decretalium explanati summa seu compendium, quod in usum maxime discipulorum suorum ex libris suis collegit auctor ipse […], 2 Bde., Augsburg
[Antonius Possevinus] (1593), Antonii Possevini Societatis Iesu Bibliothecae selectae Pars secunda, Rom
Reformation de l’Université de Paris (1601), Paris
Santamaria, Alberto (1949), Tabulae synopticae Codicis Iuris Canonici, Manila
Schram, Dominicus (1774), Epitome canonum ecclesiasticorum ex conciliis Germaniae et aliis fontibus juris ecclesiastici Germanici collecta, ac ordine alphabeti secundum materias distincta, Augsburg
Scortia, Joannis Baptista (1625), In selectas summorum pontificum constitutiones epitome, ac theoremata, Lyon
[Seneca] (1965), L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae morales, hg. v. Reynolds, Leighton Durham, Bd. 2, Oxford
Serraino, Marius (1988), Epitome juris canonici ad mentem Codicis 1983, Trapani
[Simon von Bisignano] (2014), Summa in Decretum Simonis Bisinianensis, hg. v. Aimone Braida, Pier V. (Monumenta Iuris Canonici, Series A, Bd. 8), Città del Vaticano
[Tarquini, Camillo] (1835), Institutionum juris canonici tabulae synopticae juxta ordinem habitum a Joanne Devoti, Rom
[Tarquini, Camillo] (1840), Institutionum juris canonici tabulae synopticae juxta ordinem habitum a Joanne Devoti, Florenz
|Telch, Carolus (1924), Epitome theologiae moralis universae per definitiones, divisiones et summaria principia pro recollectione moralis et ad immediatum usum confessarii et parochi excerpta e Summa theol. mor. R. P. Hier. Noldin SJ, 6. Aufl., Innsbruck
Tertullianus, Quintus Septimus Florens (1954), Apologeticum, in: Dekkers, Eligius (Hg.), Quinti Septimi Florentis Tertulliani opera, Pars I: Opera catholica, Adversus Marcionem (Corpus Christianorum, Series latina, Bd. 1), Turnhout, 77–171
The Hibernensis. A Study and Edition (2019), hg. v. Flechner, Roy (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, Bd. 17,1), Washington/D.C.
Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes (1962), hg. v. Mommsen, Theodor, Paul M. Meyer, 2 Bde., 3. Aufl., Berlin
Thesaurus theologicus (1762–1763), hg. v. Zaccaria, Francesco Antonio, 15 Bde., Venedig
Tinctus, Iulius Caesar (1583), Tabulae sive introductiones in institution[es] iuris canonici in IIII libros distinctae, Ferrara
Ugolinus, Bartholomaeus (1587), De sacramentis novae legis tabulae perutiles, Rimini
[Vacarius] (1927), The Liber Pauperum of Vacarius, hg. v. Zulueta, Francis de (The publications of the Selden Society, Bd. 44), London
Vermeersch, Arthur, Joseph Creusen (1949–1956), Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, 3 Bde., 7. Aufl., Mecheln
Walchius, Ioannis Georgius (1758), Theologiae moralis epitome tabulis analyticis expressa, Jena
Wex, Jacobus (1708), Ariadne carolino-canonica, seu doctrina theorico-practica ss. canonum, Augsburg
Wolff, Christian (1732), Tabularum Mnemonicarum constructio et usus, in: ders., Horae subsecivae Marburgenses, Bd. 2 (a. 1730), Frankfurt a. M., 468–513
Adam, Wolfgang (1988), Poetische und kritische Wälder. Untersuchungen zu Geschichte und Formen des Schreibens »bei Gelegenheit« (Beihefte zum Euphorion, Bd. 22), Heidelberg
Adversi, Aldo (1959), Saggio di un catalogo delle edizioni del »Decretum Gratiani« posteriori al secolo XV, in: Studia Gratiana 6, 281–451
Aimone, Pier V. (2016), Alcune note sulla Abbreviatio Dunelmensis della Summa Simonis Bisinianensis, in: Goering et al. (Hg.) 179–197
Alfieri, Fernanda (2010), Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI–XVII) (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie, Bd. 55), Bologna
Angelini, Paolo (2015), Annotazioni sull’epitome greca dell’Editto di Rotari, in: Historia et ius, Paper 3, http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/angelini_7.pdf
[Anon.] (1959), Alfred von Halban, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 2, Graz, 157
Aquilon, Pierre (1982), Les réalités provinciales, in: Martin, Henri-Jean, Roger Chartier (Hg.), Histoire de l’édition française 1: Le livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris, 351–363
Aquilon, Pierre, Jean-Paul Pittion (2009), Catalogue d’ouvrages juridiques manuscrits et imprimés. Exposition à la Bibliothèque municipale de Tours, in: Pittion, Jean-Paul (Hg.), Droit et justice dans l’Europe de la Renaissance. Colloque des 02–07 Juillet 2001 (Travaux du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, Bd. 17), Paris, 311–345
Arrieta, Juan Ignacio (2012), Fuero interno, in: Diccionario general de derecho canónico, Bd. 4, Cizur Menor, 139–144
Atzeri, Lorena (2008), Gesta sentus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, Neue Folge, Bd. 58), Berlin
Aubert, R. (2000), Jean Vanckel, in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Bd. 27, Paris, Sp. 752
Aubert, R. (2015), Lequeux (Jean François Marie), in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Bd. 31, Paris, Sp. 856–857
Basdevant-Gaudemet, Brigitte (2014), Histoire du droit canonique et des institutions de l’Église latine. XVe–XXe siècle, Paris
Bazzichi, Oreste (2018), Etica economica e credito nella Summa Astesana (1317). Appunti sul pensiero teologico-sociale francescano nel 1 sec. di vita, in: Miscellanea Francescana 118, 75–108
Becker, Hans-Jürgen (1998), Das kanonische Recht im vorreformatorischen Zeitalter, in: Boockmann, Hartmut et al. (Hg.), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. I. Teil (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 228), Göttingen, 9–24
Benson, Robert L., Giles Constable (Hg.) (1982), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge/MA
Bergfeld, Christoph (1977), Katholische Moraltheologie und Naturrechtslehre, in: Coing (Hg.) 999–1033
Bertram, Martin (1983), Casus legum sive suffragia monachorum. Legistische Hilfsmittel für Kanonisten im späteren Mittelalter (unter Mitarbeit von Marguerite Duynstee), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 51, 317–363 (ND: ders., Kanonisten und ihre Texte [1234 bis Mitte 14. Jh.]. 18 Aufsätze und 14 Exkurse [Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, Bd. 43], Leiden 2013, 37–90 [mit Nachtrag]), https://doi.org/10.1163/9789004228771_004
Bertram, Martin (2014), Spätmittelalterliches Kirchenrecht: Vier Anmerkungen zur Forschungslage, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 100, 563–579, https://doi.org/10.7767/zrgka-2014-0120
Beyer, Alfred (1998), Lokale Abbreviationen des Decretum Gratiani. Analyse und Vergleich der Dekretabbreviationen »Omnes leges aut divine« (Bamberg), »Humanum genus duobus regitur« (Pommersfelden) und »De his qui intra clausura monasterii consistunt« (Lichtenthal, Baden-Baden) (Bamberger theologische Studien, Bd. 6), Frankfurt a. M.
Black, Winston (2014), Teaching the Mnemonic Bishop in the Medieval Canon Law Classroom, in: Danielson, Sigrid, Evan A. Gatti (Hg.), Envisioning the Bishop: Images and the Episcopacy in the Middle Ages (Medieval Church Studies, Bd. 29), Turnhout, 377–404, https://doi.org/10.1484/m.mcs-eb.1.102239
|Blair, Ann M. (2010), Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age, New Haven
Boehmer, Heinrich (1920/21), Luther und der 10. Dezember 1520, in: Luther-Jahrbuch 2/3, 7–53
Boockmann, Hartmut (1972), Aus den Handakten des Kanonisten Johannes Urbach (Auerbach). Die Satira des Johannes Falkenberg und andere Funde zur Geschichte des Konstanzer Konzils, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 28, 497–532
Boockmann, Hartmut (1999), Urbach (Auerbach), Johannes, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, Bd. 10, Berlin, Sp. 117–121
Bott, Heinrich (1920), De epitomis antiquis, Marburg (Diss.)
Boyé, André-Jean (1959), Notes sur Jean Faure, in: Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 27–38
Boyle, Leonard E. (1974), The Summa confessorum of John of Freiburg and the Popularization of the Moral Teaching of St. Thomas Aquinas and of some of his Contemporaries, in: Maurer, Armand A. et al. (Hg.), St. Thomas Aquinas, 1274–1974. Commemorative studies, Bd. 2, Toronto, 245–268, https://doi.org/10.1484/m.tema-eb.4.00645
Boyle, Leonard E. (1982), Summae confessorum, in: Bultot, Robert (Hg.), Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Définition, critique et exploitation. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve 25–27 mai 1981 (Université catholique de Louvain, Publications de l’Institut d’études médiévales, Ser. II, Bd. 5), Louvain-la-Neuve, 227–237
Bragagnolo, Manuela (2020), Managing Legal Knowledge in Early Modern Times: Martín de Azpilcueta’s Manual of Confessors and the Phenomenon of Epitomisation, in: Duve/ Danwerth (Hg.) 187–242, https://doi.org/10.1163/9789004425736_007
Brasington, Bruce C. (1994), The Abbreviatio »Exceptiones evangelicarum«. A Distinctive Regional Reception of Gratian’s Decretum, in: Codices manuscripti 17, 95–99
Brendecke, Arndt (2015), Information in tabellarischer Disposition, in: Grunert/ Syndikus (Hg.) 43–59
Brundage, James A. (2011), E pluribus unum: Custom, the Professionalization of Medieval Law, and Regional Variations in Marriage Formation, in: Korpiola, Mia (Hg.), Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe, 1150–1600 (Medieval Law and Its Practice, Bd. 11), Leiden, 21–41, https://doi.org/10.1163/9789004211438_003
Brunner, Heinrich (1915), Quellen und Geschichte des deutschen Rechts, in: Kohler, Josef (Hg.), Enzyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, Bd. 1, 7. Aufl., München
Burmeister, Karl Heinz (1974), Das Studium der Rechte im Zeitalter des Humanismus, Wiesbaden
Buzzi, Franco (2007), La tradizione teologica milanese tra Cinque e Seicento, in: Studia Borromaica 21, 129–163
Canivez, Jean-Marie (1957), Jean de Zinna, in: Dictionnaire de droit canonique, Bd. 6, Paris, Sp. 128–129
Carrodeguas, Celestino (2003), La sacramentalidad del matrimonio. Doctrina de Tomás Sánchez, S.J. (Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas Madrid, Ser. I: Estudios, Bd. 85), Madrid
Ceulemans, Reinhart, Pieter De Leemans (Hg.) (2015), On Good Authority. Tradition, Compilation and the Construction of Authority in Literature from Antiquity to the Renaissance (Lectio. Studies in the transmission of texts & ideas, Bd. 3), Turnhout, https://doi.org/10.1484/m.lectio-eb.5.112191
Chadwick, Henry (1969), Florilegium, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 7, Stuttgart, Sp. 1131–1160
Cioranesco, Alexandre (1959), Bibliographie de la littérature française du seizième siècle, Paris
Coing, Helmut (1964), Römisches Recht in Deutschland (Ius Romanum Medii Aevi, Bd. V,6), Mailand
Coing, Helmut (Hg.) (1973), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1, München
Coing, Helmut (Hg.) (1977), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 2,1, München
Coma Fort, José Maria (2014), Codex Theodosianus. Historia de un texto (Historia del derecho, Bd. 28), Madrid
Condorelli, Orazio (2019), Guillaume Durand (c. 1230–1296), in: Descamps, Olivier, Rafael Domingo (Hg.), Great Christian Jurists in French History (Law and Christianity), Cambridge, 52–70, https://doi.org/10.1017/9781108669979.004
Conrat (Cohn), Max (1891), Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter, Bd. 1, Leipzig (ND: Aalen 1963)
Crifò, Giuliano, Stefano Giglio (Hg.) (2003), Atti dell’Accademia romanistica Costantiniana. XIV Convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera (Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza), Neapel
Cuena Boy, Francisco (2007), Exceso de leyes en Roma: ¿retórica o realidad?, in: Annaeus 4, 3–27
Dannenberg, Lars-Arne (2010), Der lange Arm des Gesetzes. Zur Stellung der franziskanischen Ordensorganisation im Lichte der Vorgaben des kirchlichen ius commune unter besonderer Berücksichtigung der Titelsumme Heinrichs von Merseburg, in: Robson, Michael, Jens Röhrkasten (Hg.), Franciscan Organisation in the Mendicant Context. Formal and informal structures of the friars’ lives and ministry in the Middle Ages (Vitra regularis, Bd. 44), Münster, 331–352
Danwerth, Otto (2020), The Circulation of Pragmatic Normative Literature in Spanish America (16th–17th Centuries), in: Duve/ Danwerth (Hg.) 89–130, https://doi.org/10.1163/9789004425736_004
De Franceschi, Sylvio Hermann (2017), La papauté intransigeante et ses craintes d’un renouveau de régalisme gallican: La mise à l’Index du Manuale compendium iuris canonici de l’abbé Jean-François-Marie Lequeux (1851), in: ders., Bernard Hours (Hg.), Droits antiromains. Juridictionalisme catholique et romanité ecclésiale (XVIe–XIXe siècles) (Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires, Bd. 33), Lyon, 215–253, https://doi.org/10.4000/books.larhra.5215
De León, Enrique (2010), La abreviación »quoniam egestas« del Decreto de Graciano, in: Erdö, Peter, Sz. Anzelm Szuromi (Hg.), Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law. Esztergom, 3–8 August 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Bd. 14), Città del Vaticano, 303–310
De León, Enrique (2012), Abbreviatio, in: Diccionario general de derecho canónico, Bd. 1, Cizur Menor, 66–68
Dell’Olmo, Luciano, Rino Scuccimarra (1983), Il beato Angelo Carletti da Chiavasso e le edizioni della Summa Angelica nei secoli XV e XVI, Chiavasso
|De Wall, Heinrich (2008a), Böhmer, Georg Ludwig, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 639
De Wall, Heinrich (2008b), Böhmer, Justus Henning, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 640–641
Di Cintio, Lucia (2013), L’»Interpretatio Visigothorum« al »Codex Theodosianus«. Il libro IX (Collana della Rivista di diritto romano, Saggi), Mailand
Di Cintio, Lucia (2018), Nuove ricerche sulla »Interpretatio Visigothorum« al »Codex Theodosianus«. Libri I–II (Collana della Rivista di diritto romano, Saggi), Mailand
Dietterle, Johannes (1903–1907), Die Summae confessorum (sive de casibus conscientiae). Von ihren Anfängen bis zu Silvester Prierias, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 24 (1903) 353–374, 520–548; 25 (1904) 248–272; 26 (1905) 59–81, 350–362; 27 (1906) 70–83, 166–188, 296–310; 28 (1907) 401–431
Doering, Lutz (2017), Fort- und Neuschreibung autoritativer Texte und Identitätsbildung im Jubiläenbuch sowie in Texten aus Qumran, in: Grohmann, Marianne (Hg.), Identität und Schrift. Fortschreibungsprozesse als Mittel religiöser Identitätsbildung (Biblisch-Theologische Studien, Bd. 169), Göttingen, 69–103, https://doi.org/10.13109/9783788731977.69
Dolezalek, Gero, Rudolf Weigand (1983), Das Geheimnis der roten Zeichen. Ein Beitrag zur Paläographie juristischer Handschriften des zwölften Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 69, 143–199, https://doi.org/10.7767/zrgka.1983.69.1.143
Dove, Richard Wilhelm (1867), Aemilius Ludwig Richter, in: Zeitschrift für Kirchenrecht 7, 273–404
Dubischar, Markus (2010), Survival of the Most Condensed? Auxiliary Texts, Communications Theory and Condensation of Knowledge, in: Horster/ Reitz (Hg.) 39–67
Dubischar, Markus (2016), Preserved Knowledge. Summaries and Compilations, in: Hose, Martin, David Schenker (Hg.), A Companion to Greek Literature (Blackwell Companions to the Ancient World), Chichester, 427–440, https://doi.org/10.1002/9781118886946.ch28
Dusil, Stephan (2018a), Wissensordnungen des Rechts im Wandel. Päpstlicher Jurisdiktionsprimat und Zölibat zwischen 1000 und 1215 (Mediaevalia Lovaniensia, Series I, Bd. 47), Leuven
Dusil, Stephan (2018b), Visuelle Wissensvermittlung in der Gratian-Handschrift Köln, Diözesan- und Dombibliothek, 128, in: Horst (Hg.) 115–137
Dusil, Stephan (2019), The Decretum of Gratian: A Janus-Faced Collection, in: Rolker, Christof (Hg.), New Discourses in Medieval Canon Law Research. Challenging the Master Narrative (Medieval Law and Its Practice, Bd. 28), Leiden, 127–144, https://doi.org/10.1163/9789004394384_009
Dusil, Stephan, Gerald Schwedler et al. (2017), Transformationen des Wissens zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Zur Einführung, in: Dusil/ Schwedler et al. (Hg.) 1–22, https://doi.org/10.1515/9783110516340-001
Dusil, Stephan, Gerald Schwedler et al. (Hg.) (2017), Exzerpieren – Kompilieren – Tradieren. Transformationen des Wissens zwischen Spätantike und Frühmittelalter (Millennium-Studien/Millennium Studies, Bd. 64), Berlin, https://doi.org/10.1515/9783110516340
Duval, André (1957), La Summa Conciliorum de Barthélemy Carranza, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 41, 401–427
Duve, Thomas (2020), Pragmatic Normative Literature and the Production of Normative Knowledge in the Early Modern Iberian Empires (16th–17th Centuries), in: Duve/ Danwerth (Hg.) 1–39, https://doi.org/10.1163/9789004425736_002
Duve, Thomas, Otto Danwerth (Hg.) (2020), Knowledge of the Pragmatici. Legal and Moral Theological Literature and the Formation of Early Modern Ibero-America (Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds, Bd. 1), Leiden, https://doi.org/10.1163/9789004425736
Ertl, Thomas (2006), Religion und Disziplin. Selbstdeutung und Weltordnung im frühen deutschen Franziskanertum (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 96), Berlin, https://doi.org/10.1515/9783110200812
Fantappiè, Carlo (2008), Chiesa romana e modernità giuridica, Bd. 1: L’edificazione del sistema canonistica (1563–1903) (Per la storia del pensiero giuridico moderno, Bd. 76), Mailand
Feola, Raffaele (1974), Canciani, Paolo, in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 17, Rom, 749–751
Figueira, Robert C. (1992), Ricardus de Mores and his Casus decretalium: the Birth of a Canonistic Genre, in: Chodorow, Stanley (Hg.), Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law. San Diego, University of California at La Jolla, 21–27 August 1988 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Bd. 9), Città del Vaticano, 168–187
Flechner, Roy (2019), Canonical Collections, in: Reynolds, Philip L. (Hg.), Great Christian Jurists and Legal Collections in the First Millennium (Law and Christianity), Cambridge, 182–197, https://doi.org/10.1017/9781108559133.007
Forschner, Benedikt, David Haubner (2019), Kein Volk der Gesetze: Anmerkungen zu Mantovanis These der multitudo legum im römischen Privatrecht, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 136, 322–344, https://doi.org/10.1515/zrgr-2019-0012
Fournier, Paul (1921), Jean Faure, légiste, in: Histoire littéraire de la France 35, Paris, 556–580 (ND: Nendeln 1971)
Fransen, Gérard (1978), Les abrégés de collections canoniques. Essai de typologie, in: Revue de droit canonique 28, 157–166
Fritsch, Matthias J. (2004), Religiöse Toleranz im Zeitalter der Aufklärung. Naturrechtliche Begründung – konfessionelle Differenzen (Studien zum achtzehnten Jahrhundert, Bd. 28), Hamburg
Frońska, Joanna (2010), Memory and the Making of Images: A Case of a Legal Manuscript, in: Manuscripta 54, 1–20, https://doi.org/10.1484/j.mss.1.100785
Frońska, Joanna (2011), Turning the Pages of Legal Manuscripts: Reading and Remembering the Law, in: Zchomelidse, Nino, Giovanni Freni (Hg.), Meaning in Motion. Semantics of Movement in Medieval Art, Princeton, 191–214
Frońska, Joanna (2013), The Memory of Roman Law in an Illuminated Manuscript of Justinian’s Digest, in: Brenner, Elma et al. (Hg.), Memory and Commemoration in Medieval Culture, Farnham, 163–179
Furtenbach, Siegfried, Herbert Kalb (1983), Die Rechtsliteratur in volkssprachiger Überlieferung in Österreich, in: Reiffenstein, Ingo (Hg.), Beiträge zur Überlieferung und Beschreibung deutscher Texte des Mittelalters (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Bd. 402), Göppingen, 115–138
Galdi, Marco (1922), L’epitome nella letteratura Latina, Neapel
|Ganivet, Pierre (2008), L’»epitomé de Lyon«: un témoin de la réception du Bréviaire dans le Sud-Est de la Gaule au VIe siècle?, in: Rouche, Michel, Bruno Dumézil (Hg.), Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil (Cultures et civilisations médiévales, Bd. 44), Paris, 279–328
Gaudemet, Jean (1965), Le Bréviaire d’Alaric et les Epitome (Ius Romanum Medii Aevi I, 2 b aa b), Mailand
Gaudemet, Jean (1991), Les vicissitudes du Gallicanisme, in: Scritti in memoria di Pietro Gismondi, Bd. 2,1 (II Università degli studi di Roma. Sezione di diritto pubblico, Bd. 1,2,1), Mailand(ND: ders., La doctrine canonique médiévale [Variorum Collected Studies Series, Bd. 435], Aldershot 1994, XIII)
Gebhardt, Ulrich C.J. (2009), Sermo Iuris: Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung (Mnemosyne, Supplements, Bd. 315), Leiden, https://doi.org/10.1163/ej.9789004176478.i-422
Gillet, R. (1957), Jean Vanckel de Cologne, in: Dictionnaire de droit canonique, Bd. 6, Paris, Sp. 127–128
Goering, Joseph (2008), The Internal Forum and the Literature of Penance and Confession, in: Hartmann/ Pennington (Hg.) 379–428
Goering, Joseph et al. (Hg.) (2016), Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, 5–11 August 2012 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Bd. 15), Città del Vaticano
Gough, Austin (1986), Paris and Rome. The Gallican Church and the Ultramontane Campaign, 1848–1853, Oxford
Grabmann, Martin (1911), Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd. 2, Freiburg (ND: Graz 1957)
Grabmann, Martin (1936), Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit (Abbreviationes, Concordantiae, Tabulae). Auf Grund handschriftlicher Forschungen dargestellt, in: ders., Mittelalterliches Geistesleben, Bd. 2, München, 424–489
Grabmann, Martin (1939), Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudiums im Mittelalter (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Heft 5), München
Grabmann, Martin (1947), Das Weiterwirken des moraltheologischen Schrifttums des hl. Thomas von Aquin im Mittelalter, in: Divus Thomas 24, 3–28 (ND: Steinbüchel, Theodor, Theodor Müncker (Hg.), Aus Philosophie und Theologie. Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag [1. November 1949], Düsseldorf 1950, 64–83)
Grosso, Giuseppe (1974), Meditazione su Tacito, sulla moltiplicazione delle leggi e sugli attuali sviluppi costituzionali, in: Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, Bd. 4, Mailand, 3509–3519
Grunert, Frank, Anette Syndikus (Hg.) (2015), Wissensspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen, Berlin
Guarino, Antonio (1996), La rimozione del diritto e l’esperienza romana, in: Labeo 42, 7–36
Haering, Stephan (1996), Johannes v. Zinna, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5, 3. Aufl., Freiburg, Sp. 978
Haferkamp, Hans-Peter (2013), Stintzing, Johann August Roderich Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 25, Berlin, 358–359
Hamesse, Jacqueline (2005), A propos de quelques techniques d’interprétation et de compilation des textes. Paraphrases, florilèges et compendia, in: Meirinhos, José Francisco (Hg.), Itinéraires de la raison. Études de philosophie médiévale offertes à Maria Cândida Pacheco (Textes et études du moyen âge, Bd. 32), Louvain-la-Neuve, 11–34, https://doi.org/10.1484/m.tema-eb.4.00193
Hamesse, Jacqueline (2015), »Florilège« et »autorité«: deux concepts en évolution depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, in: Ceulemans/ De Leemans (Hg.) 199–225, https://doi.org/10.1484/m.lectio-eb.5.109432
Hamm, Marlies, Helgard Ulmschneider (1985), Übersetzungsintention und Gebrauchsfunktion. Die »Rechtssumme« Bruder Bertholds im Kontext volkssprachlich-kanonistischer Rechtsliteratur, in: Ruh, Kurt (Hg.), Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger Forschergruppe zur Methode und Auswertung (Texte und Textgeschichte, Bd. 19), Tübingen, 53–88
Harries, Jill (2012), Roman Law and Legal Culture, in: Johnson, Scott Fitzgerald (Hg.), The Oxford Handbook of Late Antiquity, Oxford, 789–814
Hartmann, Wilfried, Kenneth Pennington (Hg.) (2008), The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140–1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX (History of Medieval Canon Law), Washington/D.C.
Hathaway, Neil (1989), Compilatio: From Plagiarism to Compiling, in: Viator 20, 19–44
Heimann-Seelbach, Sabine (1996), Diagrammatik und Gedächtniskunst. Zur Bedeutung der Schrift für die Ars memorativa im 15. Jahrhundert, in: Kintzinger, Martin et al. (Hg.), Schule und Schüler im Mittelalter. Beiträge zur europäischen Bildungsgeschichte des 9. bis 15. Jahrhunderts (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 42), Köln, 385–408
Hess, Gilbert (2015), Florilegien. Genese, Wirkungsweisen und Transformationen frühneuzeitlicher Kompilationsliteratur, in: Grunert/ Syndikus (Hg.) 97–138
Holdsworth, William (1945), A History of English Law, Bd. 5, 3. Aufl., London (ND: London 1966)
Holthöfer, Ernst (1977), Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, in: Coing (Hg.) 103–499
Honsell, Heinrich (1984), Der Gesetzesstil in der römischen Antike, in: Giuffrè, Vincenzo (Hg.), Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, Bd. 4, Neapel, 1659–1673
Horn, Norbert (1973), Die legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts, in: Coing (Hg.) 261–364
Horst, Harald (Hg.) (2018), Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek. Siebtes Symposion der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten (25. und 26. November 2016) (Libelli Rhenani, Bd. 70), Köln
Horster, Marietta, Christiane Reitz (2018), Handbooks, Epitomes, and Florilegia, in: McGill, Scott, Edward J. Watts (Hg.), A Companion to Late Antique Literature (Blackwell Companion to the Ancient World), New York, 431–450
Horster, Marietta, Christiane Reitz (Hg.) (2010), Condensing Texts – Condensed Texts (Palingenesia, Bd. 98), Stuttgart
Hurter, Hugo (1911), Nomenclator literarius theologiae catholicae, Bd. 5,1, 3. Aufl., Innsbruck (ND: New York 1963)
Hurtubise, Pierre (2005), La casuistique dans tous ses états. De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori, Montreal
Illich, Ivan (1991), Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand. Ein Kommentar zu Hugos »Didascalicon«, Frankfurt a. M.
|Johanek, Peter (1986), Literaturgattung und Wirkungsgeschichte. Überlegungen zur Werkbezeichnung der »Summe« Bruder Bertholds, in: Hauck, Karl et al. (Hg.), Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Festschrift für Ruth Schmidt-Wiegand zum 60. Geburtstag, Bd. 1, Berlin, 353–373
Johanek, Peter (1987), Rechtsschrifttum, in: Glier, Ingeborg (Hg.), Die deutsche Literatur im späten Mittelalter 1250–1370, Teil 2: Reimpaargedichte, Drama, Prosa (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 3,2), München, 396–431
Kaiser, Wolfgang (2002), Vulgarrecht, in: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 12,2, Stuttgart, Sp. 350–351
Kaiser, Wolfgang (2007), Verkürzt und wiederaufgefüllt?, in: Rechtsgeschichte 11, 182–185, http://dx.doi.org/10.12946/rg11/182-185
Kannengiesser, Charles (2002), Tyconius of Carthage, the Earliest Latin Theoretician of Biblical Hermeneutics. The current debate, in: Maritano, Mario (Hg.), Historiam perscrutari. Miscellanea di studi offerti al prof. Ottorino Pasquato (Biblioteca di scienze religiose, Bd. 180), Rom, 297–311
Kästle-Lamparter, David (2016), Welt der Kommentare. Struktur, Funktion und Stellenwert juristischer Kommentare in Geschichte und Gegenwart (Grundlagen der Rechtswissenschaft, Bd. 30), Tübingen, https://doi.org/10.1628/002268817x14817124397351
Kéry, Lotte (1999), Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400–1140). A Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature (History of Medieval Canon Law), Washington/D.C.
Kéry, Lotte (2008), Forum externum, Forum internum, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 1641–1643
Kessler, Stephan C. (2000), Gregor der Große und seine Theorie der Exegese: die Epistula ad Leandrum, in: L’esegesi dei padri latini. Dalle origini a Gregorio Magno. XXVIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Bd. 2 (Studia ephemeridis Augustinianum, Bd. 68), Rom, 691–700
Kimmel, Christina (1997), Abbreviatio des Decretum Gratiani mit Ergänzungen, in: Berschin, Walter, Kurt Hans Staub (Hg.), Fragmenta Darmstadiensia. Heidelberger Handschriften-Studien des Seminars für Lateinische Philologie des Mittelalters (III), Darmstadt, 81–88
Krüger, Paul (1912), Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts (Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, Abt. I, Teil 2), 2. Aufl., München
Kurtscheid, Bertrandus (1927), De studio juris canonici in Ordine Fratrum Minorum saeculo XIII, in: Antonianum 2, 157–202
Kümper, Hieram (2018), Populäre Rechtsliteratur, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4, 27. Lieferung, 2. Aufl., Berlin, Sp. 682–684
Kuttner, Stephan (1937), Repertorium der Kanonistik (1140–1234). Prodromus Corporis Glossarum, Bd. 1 (Studi et testi, Bd. 71), Città del Vaticano
Kuttner, Stephan (1955/56), On the Place of Canon Law in a General History of Roman Law during the Middle Ages, in: Seminar 13, 51–55
Kuttner, Stephan (1982), The Revival of Jurisprudence, in: Benson/ Constable (Hg.) 299–323 (ND: ders., Studies in the History of Medieval Canon Law [Collected studies series, Bd. 325], Aldershot 1990, [III], 5–7 [Retractationes])
Laistner, Max L. W. (1923), Notes on Greek from the Lectures of a Ninth Century Monastery Teacher, in: Bulletin of the John Rylands Library 7, 421–456
Lambertini, Renzo (1991), La codificazione di Alarico II, 2. Aufl., Turin
Lambertini, Renzo (1995), Sull’»Epitome Gai« nel »Breviarium«, in: Labeo 41, 229–238
Landau, Peter (2003), Die Breviatio canonum des Ferrandus in der Geschichte des kanonischen Rechts. Zugleich nochmals zur Benutzung der Dionysiana bei Gratian, in: Zapp, Hartmut, Andreas Weiss et al. (Hg.), Ius canonicum in oriente et occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag (Adnotationes in Ius Canonicum, Bd. 25), Frankfurt a. M., 297–309
Landau, Peter (2008), Gratian and the Decretum Gratiani, in: Hartmann/ Pennington (Hg.) 22–54
Landau, Peter (2012), Gratian, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 2, 2. Aufl., Berlin, Sp. 530–533
Landsberg, Ernst (1894), Stynna: Johannes de, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 37, Leipzig, 99
Larson, Atria A. (2011/12), An Abbreviatio of the First Recension of Gratian’s Decretum in Munich?, in: Bulletin of Medieval Canon Law 29, 51–118
Larson, Atria A. (2012), Géneros literarios canónicos, in: Diccionario general de derecho canónico, Bd. 4, Cizur Menor, 189–192
Lauranson-Rosaz, Christian (2009), Jean Barbier et son »viatoire«. Un juriste oublié du Velay au XVe siècle, in: Passé et présent du droit 7, 17–58
Lauro, Agostino (1991), Devoti, Giovanni, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd. 39, Rom, 598–603
Lehmann, Paul (1949), Mittelalterliche Büchertitel (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jg. 1948, Heft 1), München
Lendinara, Patrizia (2011), The Scholica Graecarum glossarum and Martianus Capella, in: Teeuwen, Mariken, Sinead O’Sullivan (Hg.), Carolingian Scholarship and Martianus Capella. Ninth-Century Commentary Traditions on »De nuptiis« in Context (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, Bd. 12), Turnhout, 301–361, https://doi.org/10.1484/m.celama-eb.4.3014
Lendinara, Patrizia (2016), The Scholica Graecarum glossarum and Scaliger’s »Liber glossarum ex variis glossariis collectis«, in: Bremmer Jr, Rolf H., Kees Dekker (Hg.), Fruits of Learning. The Transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages. Storehouse of Wholesome Learning IV(Mediaevalia Groningana, New Series, Bd. 21), Löwen, 351–395
L’Engle, Susan (2011), The Pro-Active Reader: Learning to Learn the Law, in: Medieval Manuscripts, Their Makers and Users. A special issue of Viator in honor of Richard and Mary Rouse, Turnhout, 51–75, https://doi.org/10.1484/m.stpmsbh-eb.1.100058
|Liebs, Detlef (1964), Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, Bd. 57), Göttingen
Liebs, Detlef (1971), »Variae lectiones« (zwei Juristenschriften), in: Studi in onore di Edoardo Volterra, Bd. 5 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma, Bd. 44), Mailand, 51–88
Liebs, Detlef (1989), Recht und Rechtsliteratur, in: Herzog, Reinhart (Hg.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Bd. 5 (Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. 8), München, 55–73
Liebs, Detlef (1997), Jurisprudenz, in: Sallmann, Klaus (Hg.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Bd. 4 (Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. 8), München, 83–217
Liebs, Detlef (2002), Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert) (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Neue Folge, Bd. 38), Berlin
Liebs, Detleff (2003), Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium Alaricianum, in: Crifò/ Giglio (Hg.) 653–671
Liebs, Detlef (2005), Nachklassische römische Rechtsliteratur, in: Thür, Gerhard (Hg.), Antike Rechtsgeschichte. Einheit und Vielfalt (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 726), Wien, 27–42
Liebs, Detlef (2008), Roman Vulgar Law in Late Antiquity, in: Sirks, Boudewijn (Hg.), Aspects of Law in Late Antiquity. Dedicated to A. M. Honoré on the occasion of the sixtieth year of his teaching in Oxford, Oxford, 35–53
Liebs, Detleff (2010), Das Verbot von Mischehen im germanisch-römischen Recht, in: Giglio, Stefano (Hg.), Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. XVII convegno internazionale in onore di Giuliano Crifò, Bd. 1 (Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia), Rom, 622–628
Liebs, Detlef (2012), Legis Romanae Visigothorum Epitomen Sangallensem […], in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 129, 1–112
Liebs, Detlef (2015), Römischrechtliche Glut aus dem 8. Jh. für ein Bischofsgericht in Burgund, in: ders., Das Recht der Römer und die Christen. Gesammelte Aufsätze in überarbeiteter Fassung, Tübingen, 256–274
Liebs, Detlef (2016), Scintilla de libro legum. L’Epitome Fuldense del Breviario Alariciano, in: Bassanelli Sommariva, Gisella, Simona Tarozzi (Hg.), Ravenna capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravivenza (Ravenna capitale), Santarcangelo di Romagna, 279–304
Liebs, Detlef (2017), Warum endete gegen Mitte des 3. Jahrhunderts die klassische Rechtsliteratur?, in: Eich, Armin et al. (Hg.), Das dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Ergebnisse der Tagung der Mommsen-Gesellschaft am 21.–22.11.2014 an der Bergischen Universität Wuppertal (Palingenesia, Bd. 108), Stuttgart, 57–73
Liebs, Detlef (2018), Wenn Fachliteratur Gesetz wird. Inwieweit wurden römische Juristenschriften im Laufe der Jahrhunderte überarbeitet?, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 135, 395–473, https://doi.org/10.26498/zrgra-2018-1350112
Lizzi, Rita (1990), La memoria selettiva, in: Cavallo, Guglielmo et al. (Hg.), Lo spazio letterario di Roma antica, Bd. 3, Rom, 647–676
Llauró, Juan (1927), Los glossarios de Ripoll, in: Analecta Sacra Tarraconensia 3, 331–389
Löhr, Joseph (1917), Das Preußische Allgemeine Landrecht und die Katholischen Kirchengesellschaften (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft, Bd. 31), Paderborn
Mantovani, Dario (2018), Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht. Nachwort: Jakob F. Stagl, Juristenrecht und Gesetzesrecht (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, Neue Folge, Bd. 78), Berlin, https://doi.org/10.3790/978-3-428-55265-8
Martin, Norbert (1994), Die »Compilatio Decretorum« des Kardinals Laborans. Eine Umarbeitung des gratianischen Dekrets aus dem 12. Jahrhundert, Heidelberg (Diss.)
Martini, Remo (2003), Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai, in: Crifò/ Giglio (Hg.) 615–627
Matthews, John F. (2001), Interpreting the Interpretationes on the Breviarium, in: Mathisen, Ralph W. (Hg.), Law, Society, and Authority in Late Antiquity, Oxford, 11–32
Mazzacane, Aldo (1997), El jurista y la memoria, in: Petit, Carlos (Hg.), Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación (Historia de la Sociedad Política), Madrid, 75–102
Meder, Stephan (2017), Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 6. Aufl., Köln
Meyer, Christoph H. F. (2000a), Spuren im Wald der Erinnerung. Zur Mnemotechnik in Theologie und Jurisprudenz des 12. Jahrhunderts, in: Recherches de théologie et philosophie médiévales 67, 10–57
Meyer, Christoph H. F. (2000b), Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters (Mediaevalia Lovaniensia, Ser. I, Bd. 29), Löwen
Meyer, Christoph H. F. (2006), Ordnung durch Ordnen. Die Erfassung und Gestaltung des hochmittelalterlichen Kirchenrechts im Spiegel von Texten, Begriffen und Institutionen, in: Schneidmüller, Bernd, Stefan Weinfurter (Hg.), Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter (Vorträge und Forschungen, Bd. 64), Ostfildern, 303–411
Meyer, Christoph H. F. (2012), Kanonistik im Zeitalter von Absolutismus und Aufklärung: Spielräume und Potentiale einer Disziplin im Spannungsfeld von Kirche, Staat und Publizität, in: Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2012-06, https://ssrn.com/abstract=2184754
Meyer, Christoph H. F. (2018), Das Vierte Laterankonzil als Einschnitt der kirchlichen Rechtsgeschichte. Zugleich zur Konzilsgesetzgebung im dreizehnten Jahrhundert, in: Ferrari, Michele C. et al. (Hg.), Europa 1215. Politik, Kultur und Literatur zur Zeit des IV. Laterankonzils (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 79), Wien, 29–92
Meyer, Christoph H. F. (2020), Putting Roman and Canon Law in a Nutshell: Developments in the Epitomisation of Legal Texts between Late Antiquity and the Early Modern Period, in: Duve/ Danwerth (Hg.) 40–88
Michaud-Quantin, Pierre (1962), Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XII–XVI siècles) (Analecta mediaevalia namurcensia, Bd. 13), Löwen, https://doi.org/10.1515/9783110826869.76
|Michaud-Quantin, Pierre (1970), Les méthodes de la pastorale du XIIIe au XVe siècle, in: Zimmermann, Albert (Hg.), Methoden in Wissenschaft und Kunst des Mittelalters (Miscellanea mediaevalia, Bd. 7), Berlin, 76–91
Michel, Paul (1999), Wo das Lamm watet und der Elefant schwimmt. Eine Darstellung von Gregors des Großen Epistola dedicatoria zu den Moralia in Iob, in: Herwig, Henriette et al. (Hg.), Lese – Zeichen. Semiotik und Hermeneutik in Raum und Zeit. Festschrift für Peter Rusterholz zum 65. Geburtstag, Tübingen, 71–86
Michelitsch, Antonius (1924), Kommentatoren zur Summa Theologiae des hl. Thomas von Aquin, Graz (ND: Hildesheim 1981)
Mondin, Luca (2007/08), Foca, Marziale e la poetica dell’epitome: la prefazione all’Ars de nomine et uerbo (con un saggio di commento), in: Incontri triestini di filologia classica 7, 329–354
Montanos Ferrín, Emma (2004), A modo de consulta sobre la literatura jurídica del ius commune, III: summa angelica, in: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 8, 1114–1146
Montorzi, Mario (2005), Processi di »standardizzazione« testuale: margaritae, gemmae, tabulae. Un primo approccio di studio, in: ders., Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d’aggregazione istituzionale attorno ed oltro il feudo. Saggi e documenti, Padua, 51–69
Moore, Philip S. (1936), The Works of Peter of Poitiers Master in Theology and Chancellor of Paris (1193–1205), Washington/D.C.
Moschetti, Guiscardo (1954), Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel sec. IX a Verona. Secondo il Cod. Vat. Lat. 5359, Spoleto
Mosiek, Ulrich (1959), Die probati auctores in den Ehenichtigkeitsprozessen der S. R. Rota seit Inkrafttreten des Codex Iuris Canonici (Freiburger theologische Studien, Bd. 74), Freiburg
Mühlmann, Sieghard (1972), Luther und das Corpus Iuris Canonici bis zum Jahre 1530. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 58, 235–305, https://doi.org/10.7767/zrgka.1972.58.1.235
Mülke, Markus (2008), Der Autor und sein Text. Die Verfälschung des Originals im Urteil antiker Autoren (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Bd. 93), Berlin
Müller, Jörg (2002), Heinrich v. Merseburg, in: Campenhausen, Axel Frhr. v. et al. (Hg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Bd. 2, Paderborn, Sp. 232–233
Müller, Wolfgang P. (2008), Rez. zu: Ch. Radding/A. Ciaralli, The Corpus iuris in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, Leiden/Boston 2007, in: Speculum 83, 1026–1027
Munier, Charles (1972/73), La tradition manuscrite de l’Abrégé d’Hippone et le canon des Écritures des églises africaines, in: Sacris erudiri 21, 43–55 (ND: ders., Vie conciliaire et collections canoniques en Occident, IVe–XIIe siècles [Collected Studies, Bd. 265], London 1987, V), https://doi.org/10.1484/j.se.2.303374
Musson, Anthony (2014), Seeing Justice: The Visual Culture of the Law and Lawyers, in: Speer, Andreas, Guy Guldentops (Hg.), Das Gesetz – The Law – La Loi (Miscellanea Mediaevalia, Bd. 38), Berlin, 711–721, https://doi.org/10.1515/9783110350081.711
Muther, Theodor (1872), Zur Geschichte des Römisch-canonischen Prozesses in Deutschland während des vierzehnten und zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts […], Rostock
Muther, Theodor (1882), Johannes Urbach, hg. v. Landsberg, Ernst (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschiche 13), Breslau
Nacci, Matteo (2010), Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum (Corona Lateranensis, Bd. 40), Città del Vaticano
Nasti, Fara (2019), Pensiero giuridico romano e tradizione europea nei Prinzipien die Fritz Schulz, in: Bonin, Pierre et al. (Hg.), Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie, Turin, 225–247
Naz, Raoul (1965), Tabula alphabetica juris, in: Dictionnaire de droit canonique, Bd. 7, Paris, Sp. 1145–1146
Nehlsen, Hermann (1977), Aktualität und Effektivität der ältesten germanischen Rechtsaufzeichnungen, in: Classen, Peter (Hg.), Recht und Schrift im Mittelalter (Vorträge und Forschungen, Bd. 23), Sigmaringen, 449–502
Nehlsen, Hermann (1982), Alarich als Gesetzgeber. Zur Geschichte der Lex Romana Visigothorum, in: Landwehr, Götz (Hg.), Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel (Rechtshistorische Reihe, Bd. 1), Frankfurt a. M., 143–203
Nemo-Pekelman, Capucine (2013), How did the authors of the Breviarium Alaricianum work? The example of the laws on Jews, in: Historical Research 86, 408–415, https://doi.org/10.1111/1468-2281.12019
Nörr, Dieter (1974), Rechtskritik in der römischen Antike (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge, Bd. 77), München
Nörr, Dieter (1978), Zum Traditionalismus der römischen Juristen, in: Jakobs, Horst Heinrich et al. (Hg.), Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Bd. 1, Köln, 153–190
Nörr, Knut Wolfgang (1973), Die Literatur zum gemeinen Zivilprozeß, in: Coing (Hg.) 383–397
Nörr, Knut Wolfgang (2002), Über den Processus Iudicii des Johannes Urbach aus dem 15. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 88, 283–293
Ocker, Christopher (1991), The Fusion of Papal Ideology and Biblical Exegesis in the Fourteenth Century, in: Burrows, Mark Stephen (Hg.), Biblical Hermeneutics in Historical Perspective. Studies in Honor of Karlfried Froehlich, on His Sixtieth Birthday, Grand Rapids, 131–151
Ocker, Christopher (1993), Johannes Klenkok: A Friar’s Life, c. 1310–1374 (Transactions of the American Philosophical Society, Bd. 83,5), Philadelphia
Oestmann, Peter (2018), Die Frührezeption des gelehrten Rechts in der sogenannten populären Literatur und der Gerichtspraxis, in: Lange, Christian R. et al. (Hg.), Islamische und westliche Jurisprudenz des Mittelalters im Vergleich, Tübingen, 123–145
|Ohst, Martin (1995), Pflichtbeichte. Untersuchungen zum Bußwesen im Hohen und Späten Mittelalter (Beiträge zur historischen Theologie, Bd. 89), Tübingen
Opelt, Ilona (1962), Epitome, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 5, Stuttgart, Sp. 944–973
Otte, Gerhard (1981), Die Rechtswissenschaft, in: Weimar, Peter (Hg.), Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert (Zürcher Hochschulforum, Bd. 2), Zürich, 123–142
Ourliac, Paul, Henri Gilles (1971), La période post-classique (1378–1500), Bd. 1: La problématique de l’époque. Les sources (Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, Bd. 13,1), Paris
Palacios, Arturo (1989), El professor de Pavía, Antonio de Gentilibus y su »Repertorium alphabeticum iuris«, in: Bulletin of Medieval Canon Law 19, 33–50
Parkes, Malcolm B. (1976), The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio on the Development of the Book, in: Alexander, Jonathan J. G., Margaret T. Gibson (Hg.), Medieval Learning and Literature. Essays presented to Richard Willliam Hunt, Oxford, 115–141
Pasciuta, Beatrice (2016), Durantis, Speculum iudiciale, in: Dauchy, Serge et al. (Hg.), The Formation and Transmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the Age of Printing (Studies in the History of Law and Justice, Bd. 7), Cham, 37–40
Pennington, Kenneth (2008), Decretal Collections, in: Hartmann/ Pennington (Hg.) 293–317
Pennington, Kenneth, Wolfgang Müller (2008), The Decretists: The Italian School, in: Hartmann/ Pennington (Hg.) 121–173
Périès, George (1890), La Faculté de droit dans l’ancienne Université de Paris (1160–1793), Paris
Phillips, George (1852), Du droit ecclésiastique dans ses sources, considérées au point de vue des éléments législatif qui les constituent, traduit par l’Abbé Crouzet, suivi d’un essai de bibliographie du droit canonique, Paris
Pieler, Peter E. (2000), Die Justinianische Kodifikation in der juristischen Praxis des 6. Jahrhunderts, in: Puliatti, Salvatore, Andrea Sanguinetti (Hg.), Legislazione, Cultura giuridica, prassi dell’impero d’oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del convegno Modena, 21–22 maggio 1998 (Collana del Dipartimento di scienze giuridiche e della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Nuova serie, Bd. 52), Mailand, 211–227
Prantl, Carl (1867), Ueber die Literatur der Auctoritates in der Philosophie, in: Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München, Bd. 2, München, 173–198
Prinz, Franziska (2006), Der Bildgebrauch in gedruckten Rechtsbüchern des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts (Gesellschaft und Recht, Bd. 5), Hamburg
Radding, Charles M. (2018), Law Books, in: Kwakkel, Erik, Rodney Thomson (Hg.), The European Book in the Twelfth Century (Cambridge Studies in Medieval Literature, Bd. 101), Cambridge, 293–310
Radding, Charles A., Antonio Ciaralli (2007), The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival (Brill’s Studies in Intellectual History, Bd. 147), Leiden
Raible, Wolfgang (1995), Arten des Kommentierens – Arten der Sinnbildung – Arten des Verstehens. Spielarten der generischen Intertextualität, in: Assmann, Jan, Burkhard Gladigow (Hg.), Text und Kommentar. Archäologie der literarischen Kommunikation IV (Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation, Bd. 4), München, 51–73
Rambaud-Buhot, Jacqueline (1955), Les divers types d’abrégés du Décret de Gratien. De la table au commentaire, in: Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel […], Bd. 2 (Mémoires et documents, Bd. 12), Paris, 397–411
Rambaud-Buhot, Jacqueline (1985), L’Abbreviatio Decreti d’Omnebene, in: Kuttner, Stephan, Kenneth Pennington (Hg.), Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law. Berkeley, California, 28 July–2 August 1980 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Bd. 7), Città del Vaticano, 93–107
Ransom, Lynn (1999), The Speculum theologie and Its Readership: Considering the Manuscript Evidence, in: The Papers of the Bibliographical Society of America 93, 461–483, https://doi.org/10.1086/pbsa.93.4.24304182
Richter, Aemilius Ludwig (1865), Beiträge zum Preussischen Kirchenrechte, hg. v. Hinschius, Paul, Leipzig
Risch, Franz Xaver (2003), Was tut ein Epitomator? Zur Methode des Epitomierens am Beispiel der pseudoclementinischen epitome prior, in: Das Altertum 48, 241–255
Rivers, Kimberly A. (2012), Remembering Canon and Civil Law around 1400, in: Nottingham Medieval Studies 56, 265–280, https://doi.org/10.1484/j.nms.1.102760
Rivers, Kimberly A. (2017), Learning and Remembering Canon Law in the Fifteenth Century: The Ars et doctrina studendi et docendi of Juan Alfonso de Benavente, in: Sharp, Tristan (Hg.), From Learning to Love. Schools, Law, and Pastoral Care in the Middle Ages. Essays in Honour of Joseph W. Goering (Papers in Mediaeval Studies, Bd. 29), Toronto, 266–290
Rivier, Alphonse (1873), Jean Bardier, sieur de Saint-Côme, et son Viatorium juris, in: Revue de législation ancienne & moderne française et étrangère 3, 213–237
Röhl, Klaus F. (2010), (Juristisches) Wissen über Bilder vermitteln, in: Dausendschön-Gay, Ulrich et al. (Hg.), Wissen in (Inter-)Aktion. Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern (Linguistik – Impulse & Tendenzen, Bd. 39), Berlin, 281–311, https://doi.org/10.1515/9783110227673.3.281
Rotondi, Giovanni (1912), Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislatoria dei comizi romani. Estratto della Enciclopedia Giuridica Italiana, Mailand (ND: Hildesheim 1966)
Roumy, Franck (1999), Un abrégé inconnu du Décret de Gratien, in: Bontems, Claude (Hg.), Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, 501–519
Rouse, Mary A. (1985), Florilegia, in: Dictionary of the Middle Ages, Bd. 5, New York, 109–110
Rouse, Mary A., Richard H. Rouse (1979), Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on the Manipulus florum of Thomas of Ireland (Studies and Texts, Bd. 47), Toronto
Rouse, Mary A., Richard H. Rouse (1982), Statim invenire. Schools, Preachers, and New Attitudes to the Page, in: Benson/ Constable (Hg.) 201–225
|Rouse, Mary A., Richard H. Rouse (1989), La naissance des index, in: Chartier, Roger, Henri-Jean Martin (Hg.), Histoire de l’édition française, Bd. 1, Paris, 95–108
Ruiz Jurado, Manuel (2010), De las Constituciones S.J. al Epítome, in: McCoog, Thomas M. (Hg.), Ite inflammate omnia. Selected historical papers from conferences held at Loyola and Rome in 2006 (Bibliotheca Instituti Historici S.I., Bd. 72), Rom, 129–147
Sánchez-Moreno Ellart, Carlos (2013), Law, »vulgar«, in: The Encyclopedia of Ancient History, Bd. 7, Malden/MA, 3975–3978
Santucci, Gianni (2014), Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo, in: Studia et documenta historiae et iuris 80, 373–393
Savelli, Rodolfo (2018), Sulla stampa del Corpus iuris civilis nel Cinquecento. Standardizzazione, innovazioni, contaminazioni, in: Levati, Stefano, Simona Mori (Hg.), Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli, Mailand, 103–125
Schadt, Hermann (1982), Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen
Schermaier, Martin Josef (2010), Fritz Schulz (1879–1957). Fritz Schulz’ Prinzipien – Das Ende einer deutschen Universitätslaufbahn im Berlin der Dreißigerjahre, in: Grundmann, Stefan et al. (Hg.), Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Berlin, 683–699, https://doi.org/10.1515/9783899496307.683
Schieffer, Rudolf (2010), Wissenschaftliche Arbeit im 9. Jahrhundert (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste, Geisteswissenschaften, Vorträge, G 425), Paderborn
Schiller, Arthur A. (1978), Roman Law. Mechanisms of Development, Den Haag
Schindler, Karl-Heinz (1966), Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen (Forschungen zum römischen Recht, Bd. 23), Köln
Schmidt-Wiegand, Ruth (1990), Rechtsverse, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4, Berlin, Sp. 410–415
Schmidt-Wiegand, Ruth (2007), Populärjurisprudenz zwischen Artesliteratur und Richterlichem Clagspiegel, in: Wich-Reif, Claudia (Hg.), Strukturen und Funktionen in Gegenwart und Geschichte. Festschrift für Franz Simmler zum 65. Geburtstag, Berlin, 537–554
Schmitt, Charles B. (1987), Auctoritates, Repertorium, Dicta, Sententiae, Flores, Thesaurus, and Axiomata: Latin Aristotelian Florilegia in the Renaissance, in: Wiesner, Jürgen (Hg.), Aristoteles Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet, Bd. 2: Kommentierung, Überlieferung, Nachleben, Berlin, 515–537
Schmitt, Cl. (1967), Jacques Ungarelli, in: Catholicisme: hier, aujourd’hui, demain, Bd. 6, Paris, Sp. 287–288
Schmoeckel, Mathias (2008), Beichtstuhljurisprudenz, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 505–508
Schönberger, Rolf (1991), Was ist Scholastik? (Philosophie und Religion, Bd. 2), Hildesheim
Schott, Clausdieter (1974), Pactus, Lex und Recht, in: Hübener, Wolfgang (Hg.), Die Alemannen in der Frühzeit (Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Bd. 34), Bühl, 135–168
Schumann, Eva (2018), Rechts- und Sprachtransfer am Beispiel der volkssprachigen Praktikerliteratur, in: Friedrich, Udo, Eva Schumann (Hg.), Transfer von Expertenwissen in der Frühen Neuzeit. Gelehrte Diskurse in der volkssprachigen Praxis, Göttingen, 61–111
Schulte, Friedrich (1868), Die canonistischen Handschriften der Bibliotheken […] in Prag (Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Folge VI, Bd. 2), Prag
Schulz, Fritz (1934), Prinzipien des römischen Rechts. Vorlesungen, München
Schulz, Fritz (1961), Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar
Schulz, Karl (1883), Zur Literärgeschichte des Corpus Juris Civilis. Festgabe zum fünfzigjährigen Amtsjubiläum seiner Excellenz des Herrn Reichsgerichtspräsidenten Dr. Eduard Simson am 22. Mai 1883 überreicht, Leipzig
Schwind, Fritz (1973), Zur Frage der Publikation im Römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet, 2. Aufl., München
Seckel, Emil (1898), Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter, Bd. 1: Zur Geschichte der populären Literatur des römisch-canonischen Rechts, Tübingen
Seckel, Emil (1921), Das römische Recht und seine Wissenschaft im Wandel der Jahrhunderte. Rede zum Antritt des Rektorates der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin gehalten in der Aula am 15. Oktober 1920, Berlin
[Seckel, Emil] (2004), Die Vorträge Emil Seckels in der Berliner Mittwochs-Gesellschaft (Teil 1), hg. v. Schubert, Werner, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 121, 501–525
[Seckel, Emil] (2006), Die Vorträge Emil Seckels in der Berliner Mittwochs-Gesellschaft (Teil 3, X.–XVI.), hg. v. Schubert, Werner, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 123, 349–374
Sedano, Joaquín (2012), Breviarium, in: Diccionario general de derecho canónico, Bd. 1, Cizur Menor, 753–754
Seipp, David J. (2019), Year Book Men, in: Ibbetson, David et al. (Hg.), English Legal History and its Sources. Essays in Honour of Sir John Baker, Cambridge, 3–22
Sieben, Hermann Josef (1988), Die katholische Konzilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung (Konziliengeschichte, Reihe B), Paderborn
Sieben, Hermann Josef (2018), Kleines Lexikon zur Geschichte der Konzilsidee (UTB, Bd. 8715), Paderborn
Siems, Harald (1989), Zu Problemen der Bewertung frühmittelalterlicher Rechtstexte. Zugleich eine Besprechung von R. Kottje, Zum Geltungsbereich der Lex Alamannorum, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische Abteilung) 106, 291–305, https://doi.org/10.7767/zrgga.1989.106.1.291
Siems, Harald (1992), Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, Bd. 35), Hannover
|Siems, Harald (2001), Adsimilare. Die Analogie als Wegbereiterin zur mittelalterlichen Rechtswissenschaft, in: Herbers, Klaus (Hg.), Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Werner Goez, Stuttgart, 143–170
Simon, Dieter (1980), Gesetzesflut – Gesetzesperfektionismus, in: Verhandlungen des dreiundfünfzigsten Deutschen Juristentages, Berlin 1980, Bd. 2 (Sitzungsberichte), München, Q 12–17
Simon, Dieter (2014), Die rechtshistorische Wende, in: Oesterreicher, Wulf, Maria Selig (Hg.), Geschichtlichkeit von Sprache und Text. Philologien – Disziplingenese – Wissenschaftshistoriographie, Paderborn, 99–113, https://doi.org/10.30965/9783846754313_007
Sinisi, Lorenzo (2004), Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti, in: Rivista di storia del diritto italiano 77, 53–95
Sirks, A. J. B. (2007), The Theodosian Code. A Study (Studia Amstelodamensia/Studies in Ancient Law and Society, Bd. 39), Friedrichsdorf
Sommervogel, Carlos, Augustin und Aloys de Backer (1898), Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Première Partie: Bibliographie, Bd. 8, 2. Aufl., Brüssel
Speer, Heino (2012), Verstehenshilfen zum geschriebenen Recht – Medienwandel als Chance. Eine Skizze, in: Speer, Heino (Hg.), Wort – Bild – Zeichen. Beiträge zur Semiotik im Recht (Akademiekonferenzen, Bd. 13), Heidelberg, 225–252
Spitz, Hans-Jörg (1972), Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Beitrag zur allegorischen Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends (Münstersche Mittelalter-Schriften, Bd. 12), München
Spruit, Johannes E. (1995), Visions fugitives, in: Feenstra, Robert et al. (Hg.), Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, Bd. 2 (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia, Bd. 35 B), Amsterdam, 489–497
Stagl, Jakob Fortunat (2016), Die Bedeutung von leges publicae im Römischen Recht: Der Beitrag Mantovanis zur »legum multitudo« und die Frage der Privatautonomie bei den Römern, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 133, 445–458
Stauffer, Marianne (1958), Der Wald. Zur Darstellung und Deutung der Natur im Mittelalter, Zürich (Diss.)
Stein, Robert (1916), Alte und neue Übersichtstafeln. Ein Beitrag zur Geschichte der Unterrichtsmittel und eine Anregung zu erneuter Verwendung, in: Deutsche Geschichtsblätter 17, 167–192, 226–248
Steinhauer, Fabian (2015), Vom Scheiden (Lectiones Inaugurales, Bd. 10), Berlin
Steinhauer, Fabian (2017), Kulturtechniken des Rechts. Anmerkungen zu einem Format der Rechtswissenschaft, in: Funke, Andreas, Konrad Lachmayer (Hg.), Formate der Rechtswissenschaft, Weilerswist, 255–272
Stickler, Alphonsus M. (1950), Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae, Bd. 1: Historia fontium, Turin
Stintzing, Roderich (1857), Ulrich Zasius. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft im Zeitalter der Reformation, Basel
Stintzing, Roderich (1867), Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, Leipzig
Stintzing, Roderich (1880), Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Erste Abtheilung (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit, Bd. 18,1), München
Stolleis, Michael (1989), »Fortschritte der Rechtsgeschichte« in der Zeit des Nationalsozialismus?, in: Stolleis, Michael, Dieter Simon (Hg.), Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 2), Tübingen, 177–197
Stolleis, Michael (2005), Vom Verschwinden verbrauchten Rechts, in: Kiesow, Rainer Maria et al. (Hg.), Summa. Dieter Simon zum 70. Geburtstag (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 193), Frankfurt a. M., 539–558
Stolleis, Michael (2007), Corpus Iuris Civilis par cœur, in: Haferkamp, Hans-Peter, Tilman Repgen (Hg.), Usus modernus pandectarum. Römisches Recht, Deutsches Recht und Naturrecht in der Frühen Neuzeit. Klaus Luig zum 70. Geburtstag (Rechtsgeschichtliche Schriften, Bd. 24), Köln, 245–269
Stolleis, Michael (2014), Vom Umgang mit veralteten Büchern, oder: Mit den Toten sprechen, in: Nolte, Jakob et al. (Hg.), Die Verfassung als Aufgabe von Wissenschaft, Praxis und Öffentlichkeit. Freundesgabe für Bernhard Schlink zum 70. Geburtstag, Heidelberg, 15–24
Taliadoros, John (2006), Law and Theology in Twelfth-Century England. The Works of Master Vacarius (c. 1115/20–c. 1200) (Disputatio, Bd. 10), Turnhout, https://doi.org/10.1484/m.disput-eb.5.105962
Tardif, Adolphe (1890), Histoire des sources du droit français, origines romaines, 2. Aufl., Paris
Tardif, Ernest-Joseph (1895), Un abrégé juridique des Étymologies d’Isidore de Séville, in: Tardif, Ernest-Joseph (Hg.), Mélanges Julien Havet. Recueil des travaux d’érudition dédiés à la mémoire de Julien Havet (1853–1893), Paris, 659–681
Thesaurus linguae Latinae (1931–1953), Bd. 5,2, Leipzig
Trump, Dominik (2016), Römisches Recht in Reims: Ein Exzerpt aus der Epitome Aegidii in der Handschrift Mailand, Biblioteca Ambrosiana, A. 46 inf., in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 133, 322–371
Trump, Dominik (2019), In margine – Annotationen in der Handschrift Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4417, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 136, 364–371, https://doi.org/10.1515/zrgr-2019-0015
Trusen, Winfried (1962), Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Frührezeption (Recht und Geschichte, Bd. 1), Wiesbaden
Trusen, Winfried (1971), Forum internum und gelehrtes Recht im Spätmittelalter. Summae confessorum und Traktate als Wegbereiter der Rezeption, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 57, 83–126
Trusen, Winfried (1990), Zur Bedeutung des geistlichen Forum internum und externum für die spätmittelalterliche Gesellschaft, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 76, 254–285
Ubl, Karl (2017), Eine Verdichtung der Lex Salica. Die Septinas septem der Handschrift Paris, BN, lat. 4411, in: Dusil/ Schwedler et al. (Hg.) 223–244, https://doi.org/10.1515/9783110516340-014
|Ubl, Karl (2018), Die Recapitulatio solidorum aus der Zeit Karls des Großen. Studie und Edition, in: Grosse, Rolf, Michel Sot (Hg.), Charlemagne: les temps, les espaces, les hommes. Construction et déconstruction d’un règne (Collection Haut Moyen Âge, Bd. 34), Turnhout, 61–79
Ullmann, Walter (1953), The Paleae in Cambridge Manuscripts of the Decretum, in: Studia Gratiana 1, 161–216
van Hove, Alphonse (1945), Prolegomena (Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Bd. 1,1), 2. Aufl., Mecheln
Vetulani, Adam, Wacław Uruszczak (1976), L’œuvre d’Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai, in: Kuttner, Stephan (Hg.), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law. Toronto, 21–25 August 1972 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Bd. 5), Città del Vaticano, 11–26
Viora, Mario E. (1936), La Summa Angelica, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 38, 443–451
von Halban, Alfred (1901), Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten, Bd. 2 (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. 64), Breslau
von Halban, Alfred (1907), Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten, Bd. 3 (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. 89), Breslau
von Savigny, Friedrich Carl (1850), Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Bd. 6, 2. Aufl., Heidelberg (ND: Bad Homburg 1961)
von Scherer, Rudolf (1886), Handbuch des Kirchenrechtes, Bd. 1, Graz
von Schulte, Johann Friedrich (1870a), Zur Geschichte der Literatur über das Dekret Gratians. Dritter Beitrag, in: Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, Philosophisch-historische Klasse, Bd. 65, Wien, 21–76
von Schulte, Johann Friedrich (1870b), Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, Bd. 1, Stuttgart (ND: Graz 1956)
von Schulte, Johann Friedrich (1877), Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, Bd. 2, Stuttgart (ND: Graz 1956)
von Schulte, Johann Friedrich (1880), Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, Bd. 3, Stuttgart (ND: Graz 1956)
von Schwerin, Claudius (1934), Die Epitome Guelferbytana zum Breviarium Alaricianum, in: Atti del Congresso internazionale di diritto romano, Bd. 1 (Bologna e Roma XVII–XXVII Aprile MCMXXXIII), Bologna, Pavia, 167–196
Waelkens, Laurent (2015), Le Décret de Gratien, un florilège de textes juridiques des années 1130, in: Ceulemans/ De Leemans (Hg.) 245–262, https://doi.org/10.1484/m.lectio-eb.5.109434
Weckwerth, Alfred (1972), Der Name »Biblia pauperum«, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 83, 1–33
Wei, John C. (2016), The Later Development of Gratian’s Decretum, in: Goering et al. (Hg.) 149–159
Weigand, Rudolf (1986), Die frühen kanonistischen Schulen und die Dekretabbreviatio Omnebenes, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 155, 72–91
Weigand, Rudolf (1991), Die Dekretabbreviatio »Quoniam egestas« und ihre Glossen, in: Aymans, Winfried et al. (Hg.), Fides et ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag, Regensburg, 249–265
Weigand, Rudolf (1994), Die Dekretabbreviatio »Exceptiones ecclesiasticarum regularum« und ihre Glossen, in: Alzati, Cesare (Hg.), Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi, Bd. 1,2, Rom, 511–529
Weimar, Peter (1973), Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in: Coing (Hg.) 129–260
Weiss, Egon (1950), Schwund und Konservierung im römischen juristischen Schrifttum, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 67, 501–511, https://doi.org/10.7767/zrgra.1950.67.1.501
Wejwoda, Marek (2012), Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, Universität und kirchlicher Karriere. Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich von Bocksdorf (ca. 1410–1466) (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, Bd. 42), Leiden
Wieacker, Franz (1960), Textstufen klassischer Juristen (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, Bd. 45), Göttingen
Wieacker, Franz (2006), Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Abschnitt: Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment, hg. v. Wolf, Joseph Georg (Handbuch der Altertumswissenschaft, Abteilung 10, Teil 3, Bd. 1, Abschnitt 2), München
Winfield, Percy H. (1925), The Chief Sources of English Legal History, Cambridge/MA
Winroth, Anders (2000a), The Making of Gratian’s Decretum (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series, Bd. 49), Cambridge
Winroth, Anders (2000b), Rez. zu: Alfred Beyer, Lokale Abbreviationen des Decretum Gratiani. […], Frankfurt am Main 1998, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 86 (2000) 567–568
Winroth, Anders (2013), Where Gratian Slept: The Life and Death of the Father of Canon Law, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kanonistische Abteilung) 99, 105–128
Winter, Steven L. (1995), A Clearing in the Forest, in: Metaphor and Symbolic Activity 10, 223–245, https://doi.org/10.1207/s15327868ms1003_5
Winteroll, Hans Michael (1987), Summae innumerae. Die Buchanzeigen der Inkunabelzeit und der Wandel lateinischer Gebrauchstexte im frühen Buchdruck (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, Bd. 193), Stuttgart
Wittekind, Susanne (2018), Überlegungen zur Verwendung graphischer Marginalien in Rechtshandschriften ausgehend von Dom-Handschrift 127, in: Horst (Hg.) 83–114
Wölfflin, Eduard (1902), Epitome, in: Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 12, 333–344
Worm, Andrea (2012), »Ista est Jerusalem«. Intertextuality and Visual Exegesis in Peter of Poitiers’ Compendium historiae in genealogia Christi and Werner Rolevinck’s Fasciculus temporum, in: Donkin, Lucy, Hanna Vorholt (Hg.), Imagining Jerusalem in the Medieval West (Proceedings of the British Academy, Bd. 175), Oxford, 123–161
Worm, Andrea (2018), Medium und Materialität. Petrus von Poitiers’ Compendium historiae in genealogia Christi in Rolle und Codex, in: Carmassi, Patrizia, Gia Toussaint (Hg.), Codex und Material (Wolfenbütteler Mittelalter-Schriften, Bd. 34), Wiesbaden, 39–63
Worstbrock, Franz Josef (1996), Libri pauperum. Zu Entstehung, Struktur und Gebrauch einiger mittelalterlicher Buchformen der Wissensliteratur seit dem 12. Jahrhundert, in: Meier, Christel et al. (Hg.), Der Codex im Gebrauch (Münstersche Mittelalter-Schriften, Bd. 70), München, 41–60
Zapp, Hartmut (1980), Abbreviationes, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München, Sp. 16
* Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um die deutsche, teilweise überarbeitete und erweiterte Fassung eines ursprünglich in englischer Sprache publizierten Artikels. Vgl. Meyer (2020).
1 Von Halban (1907) 90. Vgl. auch von Halban (1901) 351. Zum Autor vgl. [Anon.] (1959).
2 So verurteilte etwa der Philologe Isaac Casaubon (1559–1614) die pestis … compendiorum et epitomarum confectio. Vgl. [Casaubon] (1709) 62. Für ähnliche Vorstellungen vgl. Bacon (1858) 506 (Lib. II cap. 6). Das negative Bild der Epitome veranlasste gelegentlich zu apologetischen Bemerkungen. Vgl. Olearius (1694), Vorrede Auditoribus suis. Zu den antiken Hintergründen vgl. Mülke (2008) 95–108.
3 Meder (2017) 108: »Die Vulgarisierung nimmt damit ihren Anfang, dass die klassischen Juristenschriften nach Mitte des 3. Jahrhunderts zum Teil verloren gehen, zum Teil aber auch schlecht überliefert oder von Bearbeitern entstellt werden. Beispiele für solche Bearbeitungen sind die Pauli Sententiae (5 Bücher) oder die Ulpian [sic!] Regulae (7 Bücher), die nicht von Paulus oder Ulpian stammen. Es handelt sich um später hergestellte Auszüge ( epitome) aus ihren Werken. Die Verfasser sind unselbständige Epigonen, die es nicht wagen, ihre Texte unter eigenem Namen zu veröffentlichen.«
4 Dabei ging es insbes. um das römische Recht der Spätantike und des Frühmittelalters (z.B. D. Liebs, H. Siems) sowie das klassische kanonische Recht des Hoch- und Spätmittelalters (z.B. J. Rambaud-Buhot, R. Weigand). Vgl. Liebs (1964); Liebs (1971); Liebs (2012); Liebs (2015); Liebs (2016); Siems (1992) 191–200; Rambaud-Buhot (1955); Rambaud-Buhot (1985); Weigand (1986); Weigand (1991); Weigand (1994).
5 Duve (2020) 2f.; Simon (2014); Steinhauer (2017).
6 Zu Epitomen allgemein vgl. Galdi (1922); Opelt (1962); Lizzi (1990); Horster/ Reitz (Hg.) (2010); Dubischar (2016); Dusil/ Schwedler et al. (Hg.) (2017); Horster/ Reitz (2018). Zum lateinischen Wort epitome bzw. epitoma vgl. Thesaurus linguae Latinae (1931–1953) Bd. 5, Sp. 692, Z. 20–75 (s.v. epitome). Ferner vgl. Wölfflin (1902) und Galdi (1922) 17–22.
7 Laistner (1923) 436: Epitome: supercisio quae de maiori corpore librorum carptim ac defloratim excerpitur, quae alio nomine brevis expositio ac succincta potest appellari. Quonomine solent Graecorum auctores succinctas et defloratas ex aliis doctoribus expositiunculas appellare. Vgl. auch Llauró (1927) 358, Z. 199–203. Zu den Scholica Graecarum glossarum vgl. Lendinara (2011); Lendinara (2016).
8 Siehe Anm. 6. Zu Entsprechungen in antiken und mittelalterlichen Buchtiteln vgl. Lehmann (1949) 10–18.
9 Raible (1995) 56–61. Vgl. auch Doering (2017) 72f. Dubischar ordnet die Epitomen der von ihm definierten Kategorie der Auxiliartexte zu. Vgl. Dubischar (2010).
10 Risch (2003) 242.
11 Mülke (2008) 105f.
12 Opelt (1962) 945 unter Bezugnahme auf Bott (1920).
13 Zum (lateinischen) Florileg vgl. Chadwick (1969); Rouse (1985); Hamesse (2015); Hess (2015); Horster/ Reitz (2018).
14 Harries (2012) 794f. Für einen ersten Überblick zu Epitomen des römischen Rechts vgl. Galdi (1922) 224–228; Opelt (1962) 955, 965f.
15 Das bedeutet jedoch nicht, dass Gesetze und Gesetzgebung für das klassische römische Recht eine so untergeordnete Rolle spielten, wie es vielleicht Fritz Schulz’ berühmte Bemerkung über die Römer nahelegt: »Das ›Volk des Rechts‹ ist nicht das Volk des Gesetzes.« Vgl. Schulz (1934) 4. Zu den in der Forschung unterschiedlich eingeschätzten zeitgeschichtlichen Hintergründen der Schulz’schen Auffassungen vgl. Stolleis (1989) 185f.; Schermaier (2010) 696ff.; Stagl (2016) 456ff.; Forschner/ Haubner (2019) 342f.; Nasti (2019) 239f. Vgl. auch Anm. 26–28.
16 Seckel (1921) 11. Vgl. Wieacker (1960) 151f.
17 Zur Entwicklung seit dem 3. Jahrhundert vgl. Liebs (2017); Liebs (1997); Liebs (2005); Liebs (1989). Zu Epitomen und Epitomierung im klassischen römischen Recht vgl. Schulz (1961) 226ff.; Schiller (1978) 388f.
18 Liebs (2018) 401ff.
19 Stolleis (2014).
20 Wieacker (2006) 43 Anm. 59.
21 Seckel zufolge kam es knapp ein Jahrtausend später zu einer ähnlichen Katastrophe des Vergessens, als der Siegeszug der Glossa ordinaria des Accursius dazu führte, dass die Werke der hochmittelalterlichen Glossatoren des römischen Rechts in Vergessenheit gerieten. Vgl. Seckel (1921) 18 sowie Kästle-Lamparter (2016) 178f. In einem 1921 gehaltenen Vortrag (»Das Corpus iuris civilis«) wendete Seckel den Begriff der Katastrophe des Vergessens auch auf Entwicklungen in der neuzeitlichen Rechtsgeschichte an. Vgl. [Seckel] (2006) 371f. sowie Spruit (1995) 494f.
22 Stolleis (2005). Vgl. auch Guarino (1996).
23 Zur Waldmetapher allgemein vgl. Stauffer (1958) 140–145; Spitz (1972) 130–134; Adam (1988) 57–71; Winter (1995); Kannengiesser (2002) 307f.
24 Tertullianus (1954) IV,7, S. 93: Nonne et uos cottidie, experimentis inluminantibus tenebras antiquitatis, totam illam ueterem et squalentem siluam legum nouis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruspatis et caeditis? Vgl. Nörr (1974) 58; Nörr (1978) 175.
25 Schwind (1973) 35; Grosso (1974); Honsell (1984) 1664f.; Mantovani (2018) 20–25.
26 Rotondi (1912). Zum neuen Forschungsstand vgl. Mantovani (2018) sowie (dagegen) Forschner/ Haubner (2019).
27 Schulz (1934) 6; Santucci (2014) 377 bzw. 381. Ferner vgl. Simon (1980).
28 Honsell (1984) 1664; Cuena Boy (2007); Mantovani (2018) 102–107.
29 Theodosiani libri XVI (1962), Nov. Theod. 1,1.3, S. 3f.: » […] si copia inmensa librorum […] verum egimus negotium temporis nostri et discussis tenebris conpendio brevitatis lumen legibus dedimus […] Quamobrem detersa nube voluminum […] conpendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramos, […].« Ferner vgl. Codex Iustinianus (1970) 1,17,2,17 (Const. Tanta § 17), S. 73 (a. 533): Mirabile autem aliquid ex his libris emersit, quod multitudo antiqua praesente brevitate paucior invenitur. […] ut egena quidem antiqua multitudo inveniatur, opulentissima autem brevitas nostra efficiatur.Ebd. 5,4,24, S. 197 (a. 530): Sic […] immensa librorum volumina ad mediocrem modum tandem pervenient.
30 Theodosiani libri XVI (1962). Vgl. Sirks (2007); Atzeri (2008); Coma Fort (2014).
31 Lex Romana Visigothorum (1849); Legis Romanae Wisigothorum fragmenta (1896). Vgl. Nehlsen (1982); Lambertini (1991); Lambertini (1995); Liebs (2003); Martini (2003); Nemo-Pekelman (2013).
32 Conrat (1891) 222–240; von Schwerin (1934); Gaudemet (1965); Siems (1992) 194f.; Liebs (2002) 249–254; Ganivet (2008); Trump (2016); Trump (2019).
33 Lex Romana Visigothorum (1849) 3 ( Epitome Monachi, Prologus): Quisquis oportuna vacatione minime perfruitur aut capacitate sensus vel prudentia plene imbutus non invenitur, ut iura librorum, id est leges Romanorum plenissime perscrutentur, hoc quod a nobis parvum volumen, quasi de magnis silvis surculum abscissum videtur integre perlegi non aborreat, et videbitur sibi non parvum in huius operis brevitatis inesse compendium, dum sublatis pragmaticis vel longissimis assertionibus et tamen omnes eorum definiciones in hac nostra reperiantur scedula. Volumus etiam omnia capitula legis huius integra admonitione contexere, ut si qua aliqua requirenda sunt, absque mora de hoc Breviario nostro possis in auctorem volum transire. Dignum videtur, ut hoc nostra exemplaria quasi edita subolis suae matris imitetur: […] Für einen leicht abweichenden Prologtext vgl. Liebs (2002) 250. Zum Werk und den hier zu betrachtenden Passagen vgl. Conrat (1891) 238f.; Gaudemet (1965) 46f.; Siems (1992) 194f.; Liebs (2002) 249–254 (hier 250f.); Coma Fort (2014) 331f.
34 Vgl. auch [Hieronymus] (1982) c. 39, Z. 6–7: De tanta librorum silua, unum fruticem ac surculum proferre non potes.
35 Lex Romana Visigothorum (1849) XXIX–XXX; Gaudemet (1965) 46; Liebs (2002) 250. Zu den Interpretationes vgl. Matthews (2001); Di Cintio (2013); Di Cintio (2018).
36 Dazu vgl. Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina) (1900) XLVIf.; Siems (1992) 194f.; Siems (2001) 153.
37 Gregorius Magnus (1979), Epistola ad Leandrum, cap. 5, S. 7, Z. 223–225. Zu dem Werk vgl. Michel (1999); Kessler (2000).
38 Gregorius Magnus (1979), Epistola ad Leandrum, cap. 5, S. 7, Z. 223–225: Ex qua nimirum quia nostra expositio oritur, dignum profecto est, ut quasi edita soboles speciem suae matris imitetur. Vgl. Lex Romana Visigothorum (1849) 3 ( Epitome Monachi, Prologus): Dignum videtur, ut hoc nostra exemplaria quasi edita subolis suae matris imitetur. Die nicht-kursiven Hervorhebungen zeigen die Übereinstimmungen und stammen vom Verfasser.
39 Liebs (2002) 251.
40 Vielleicht entspricht dies auch der Sicht des Verfassers auf sein Werk. Vgl. Liebs (2010) 626.
41 Siems (2001) 153.
42 Liebs (2002) 253.
43 Siehe S. 53. Zum Frühmittelalter vgl. Schieffer (2010) 9.
44 Krüger (1912) 425–428; Siems (1992) 306f. (mit weiterer Literatur). Gegen diese von Krüger entwickelte Theorie haben sich in jüngerer Zeit Radding und Ciaralli ausgesprochen. Vgl. Radding/ Ciaralli (2007) 133–168 sowie Radding (2018) 300f. Allerdings beruht die Argumentation der beiden Autoren auf einer umfassenden – und umstrittenen – Spätdatierung der entscheidenden Werke und Texte. Vgl. Kaiser (2007); Müller (2008).
45 [Seneca] (1965) ep. 94, 38, S. 373, Z. 8–9: Legem enim brevem esse oportet, quo facilius ab inperitis teneatur. Zu dem Ideal der brevitas, das römische Schriftsteller in den Zwölftafeln verwirklicht sahen, vgl. Gebhardt (2009) 38ff. Mit dem Postulat der brevitas eng verbunden waren andere Idealvorstellungen wie etwa die bei Justinian prominente Forderung nach simplicitas. Vgl. Schindler (1966) 339ff. Zu einer allgemeinen Tendenz zur Simplifizierung, die Schulz im römischen Recht zwischen dem Ende des 3. Jahrhunderts und dem ersten Drittel des 6. Jahrhunderts beobachtet hat, vgl. Schulz (1961) 366–371. Bei dieser Entwicklung handelt es sich keineswegs um eine Form von Dekadenz. Vgl. Dusil/ Schwedler et al. (2017) 9f.
46 Zur Diskussion über Effektivität spätantiker und frühmittelalterlicher Rechtstexte vgl. Schott (1974); Nehlsen (1977); Siems (1989).
47 In eine ähnliche Richtung dachte vielleicht schon Paolo Canciani (1725–1810). Vgl. Canciani (1781) XIIf. Zur Person vgl. Feola (1974). Ferner vgl. Brunner (1915) 85.
48 Kaiser (2002); Liebs (2008); Sánchez-Moreno Ellart (2013).
49 Weiss (1950); Schiller (1978) 384; Gaudemet (1965) 42.
50 Für das langobardische Recht vgl. Moschetti (1954) 151–167; Angelini (2015). Zur fränkischen Rechtstradition vgl. Ubl (2017); Ubl (2018). Vereinzelt bleibt auch das Isidor-Exzerpt De legibus divinis et humanis. Vgl. Tardif (1895).
51 Für einige Belege zu epitomierten Kirchenrechtssammlungen vor dem Decretum Gratiani, d.h. vor dem zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts, vgl. Kéry (1999) 11, 21f., 57–60, 81f., 147f., 180f., 187, 206, 241, 252, 264, 287. Zu den vorgratianischen Kirchenrechtssammlungen allgemein vgl. Flechner (2019).
52 Im Prolog der Collectio Hibernensis, einer systematisch geordneten Kirchenrechtssammlung aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, werden sie auf folgenden Punkt gebracht. Der Verfasser des Werkes will die ingens silva scriptorum auf eine kurze, vollständige und harmonische Darstellung zurechtstutzen. Vgl. The Hibernensis (2019) 1: Senodicorum exemplariorum innumerositatem conspiciens ac plurimorum ex ipsis obscuritatem rudibus minus utilem prouidens, necnon ceterorum diuersitatem inconsonam destruentem magis quam edificantem prospiciens, breuem planamque ac consonam de ingenti silua scriptorum in unius uoluminis textum expossitionem degessi, […].
53 Munier (1972/73); Landau (2003); Kéry (1999) 57–60; Sedano (2012).
54 Otte (1981); Kuttner (1982).
55 Petrus Lombardus (1971) Prologus n. 5, S. 4, Z. 23–26: […] brevi volumine complicans Patrum sententias, appositis eorum testimoniis, ut non sit necesse quaerenti librorum numerositatem evolvere, cui brevitas collecta quod quaeritur offert sine labore. Vgl. Grabmann (1911) 84f.; Rouse/ Rouse (1989) 97. Zur Entwicklung insgesamt vgl. Parkes (1976); Rouse/ Rouse (1982); Hathaway (1989); Illich (1991); Hamesse (2005). Zu den gelehrten Rechten vgl. Dolezalek/ Weigand (1983); Montorzi (2005); Meyer (2006) 338f.; L’Engle (2011).
56 Schönberger (1991) 83–86.
57 Zum Kirchenrecht vgl. von Scherer (1886) 259.
58 Zu Epitomen in der römischrechtlichen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts vgl. Weimar (1973) 251–258. Zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Common Law vgl. Winfield (1925) 200–251; Seipp (2019).
59 Winroth (2000a); Winroth (2013); Landau (2008); Wei (2016); Dusil (2018a) 329–412; Dusil (2019). Zum Florilegcharakter des Decre-tum Gratiani vgl. Waelkens (2015) 258f.
60 Zu Omnibus (Omnebene) siehe oben Anm. 4. Ferner vgl. Vetulani/ Uruszczak (1976).
61 Martin (1994); Dusil (2018a) 454–461.
62 Kuttner (1937) 257–271; Ullmann (1953) 175 Anm. 26; Zapp (1980); Beyer (1998); Fransen (1978) 160; Brasington (1994); Kimmel (1997); Roumy (1999); Landau (2008) 46f.; Pennington/ Müller (2008) 123–125; Larson (2011/12); de León (2012).
63 Beyer (1998).
64 Kuttner (1937) 228–239; Figueira (1992) 174f. Für die entsprechenden dekretalistischen Gattungen vgl. Kuttner (1937) 397–415. Zu den Casus vgl. auch Bertram (1983).
65 Worstbrock (1996) 46f. Ferner vgl. von Schulte (1870a) 26–29; Schmidt-Wiegand (1990); Black (2014).
66 Zur Mnemotechnik vgl. Mazzacane (1997); Meyer (2000a); Stolleis (2007); Rivers (2012); Rivers (2017). Zur mnemotischen Funktion scholastischer Seitengestaltung vgl. Frońska (2010); Frońska (2011); Frońska (2013). Ferner vgl. Anm. 143–158.
67 Von Schulte (1877) 66, 492–495; van Hove (1945) 484–486; Ourliac/ Gilles (1971) 121–123; Pennington (2008) 304. Zu Abbreviationen von Dekretalensammlungen vor 1234 vgl. Kuttner (1937) 434–437.
68 Allerdings finden sich auch Epitomen zu dekretistischen Werken. So etwa im Zusammenhang mit der zwischen 1177 und 11789 verfassten Summe des Simon von Bisignano. Vgl. [Simon von Bisignano] (2014); Aimone (2016).
69 Von Schulte (1877) 483; Larson (2012) 191f. Zu Epitomen in der scholastischen Theologie und Philosophie vgl. Prantl (1867); Michelitsch (1924) 171–176; Grabmann (1936) 425–452; Grabmann (1939); Schmitt (1987).
70 Von Schulte (1877) 485–489; van Hove (1945) 486ff.; Ourliac/ Gilles (1971) 125f. Ferner vgl. Horn (1973) 349–354.
71 Von Schulte (1870b) 219 Anm. 10; von Scherer (1886) 259; Worstbrock (1996) 43–46; Hamesse (2005) 23f.
72 Zum Liber pauperum vgl. [Vacarius] (1927); Taliadoros (2006). Zu Quoniam egestas siehe oben Anm. 4 sowie de León (2010). Bei der Bestimmung der Adressatengruppen ist allerdings das große Bedeutungsspektrum von pauper zu berücksichtigen. Vgl. Weckwerth (1972) 22ff.
73 Kurtscheid (1927) 168–169: Cum summam henrici fratribus legerem et quosdam casus lectioni insererem, quos textus eiusdem summule non habebat, fratres multimodis precibus ac importunis instanciis me rogarunt, ut eosdem casus verbis brevibus et simplicibus annotarem, quatenus fratres simplices ad planiciem eorundem casuum expediendis penitencium perplexitatibus recurrerent, qui non possent se ac confitentes sibi in latebrosa silva iuris canonici ad liquidum expedire […] Igitur de textu decretalium et decretorum et de summis ac apparatibus magistrorum famosorum ac valde nominatorum in iure canonico cum magnis laboribus et crebris vigiliis casus quosdam prout potui collegi, et certis titulis prout eorum materie magis videbatur congruere annotavi. Vgl. auch Kurtscheid (1927) 169–172 (zum Werk); von Schulte (1877) 535f.; Ertl (2006) 410f. (Text); Goering (2008) 424. Zur Literaturgattung der Casus siehe oben Anm. 64.
74 Zu Heinrich von Merseburg und seiner Summe vgl. Müller (2002); Dannenberg (2010) 344–347.
75 Für eine zum Teil abweichende Übersetzung vgl. Ertl (2006) 281.
76 So z.B. bei dem Kanonisten Stephan von Tournai (1128–1203). Vgl. Étienne de Tournai (1893) Ep. 274 (a. 1182), 345 ( inextricabilis silva decretalium epistolarum). Dieselbe Metapher findet sich bei Petrus Blesensis (um 1135–1211) mit Blick auf die Digesten. Vgl. Petrus Blesensis (1855) Ep. 140, Sp. 416C : Vides, quam imperscrutabilis abyssus, quam dumosa silva, quam immeabile pelagus sit Pandecta, in qua civile jus continetur: cui tota aetas hominis non sufficit, cujus fructus totus in elatione et ambitione consistit. Zu den antik-patristischen Ursprüngen vgl. Alanus de Insulis (1855) Sp. 944C. Ferner vgl. Meyer (2006) 350–353.
77 Dazu allgemein aus Sicht des kanonischen Rechts vor der Kodifikation von 1917 vgl. Stickler (1950) 371–376.
78 Kuttner (1955/56) 55. Vgl. auch Anm. 82.
79 Von Schulte (1877) 478; Bergfeld (1977) 1009. Ferner vgl. Michaud-Quantin (1970); Furtenbach/ Kalb (1983).
80 Zum Forum internum vgl. Kéry (2008); Arrieta (2012).
81 Schulte (1868) 102–105; von Schulte (1877) 66, 410; Kuttner (1937) 448.
82 Zu der vielschichtigen Bezeichnung simplices vgl. Bertram (1983) 328f. (ND: 51); Brundage (2011) 25. Vgl. aber auch Meyer (2018) 78f. Gelegentlich findet sich ferner der Ausdruck rudes. So etwa in der in den 1330er Jahren verfassten Summa rudium. Vgl. von Schulte (1877) 528f.; Dietterle (1906) 78–81. Zu dem mit simplices teilweise korrelierenden Terminus pragmatici vgl. Duve (2020) 22f.
83 Stintzing (1867); Stintzing (1880) 77–85. Ferner vgl. Schmidt-Wiegand (2007). Zur Kritik an Stintzing und seinem Begriff der populären Literatur siehe unten Anm. 104.
84 Bertram (2014) 573–576; Schumann (2018) 73; Oestmann (2018) 131f.; Duve (2020) 20–25.
85 Zur Gattung vgl. Boyle (1982); Schmoeckel (2008); Goering (2008) 418–427. Zu den Auszügen vgl. Boyle (1974).
86 Das bezeugt für das 16. Jahrhundert etwa Melchor Cano (1509–1560). Vgl. Canus (1563) Lib. VIII, cap. 6, 283. Das gilt auch für Martin Luther, der die Summa Angelica erst studierte und dann am 10. Dezember 1520 zusammen mit der Bannbulle und Teilen des Corpus Juris Canonici verbrannte. Vgl. [Luther] (1919) 680, Nr. 6471: Ego Martinus Lutherus volens cognoscere iura ecclesiastica legi Summam Angelicam. Dazu vgl. Boehmer (1920/21); Mühlmann (1972) 275f. und Ohst (1995) 223f. bzw. 295. Zur Summa Angelica siehe Anm. 87.
87 Zur Summa Angelica allgemein vgl. Viora (1936); Montanos Ferrín (2004). Zu den Zusätzen und Giacomo Ungarelli vgl. Schmitt (1967); Buzzi (2007) 144. Nicht zugänglich war dem Verfasser die Monographie: dell’Olmo/ Scuccimarra (1983).
88 Ocker (1991) 137ff.; Ocker (1993) 22 Anm. 21.
89 Stintzing (1867) 229–234; Stintzing (1880) 14f.; Muther (1872) 1–31; von Schulte (1877) 254f.; Coing (1964) 202f.; Canivez (1957); Haering (1996).
90 [Johannes von Zinna] (1511) fol. 2r: Proposui igitur, adiutorio dei me pro tali opere occupare, quod occupatum in scientia iuris canonici aliqualiter instrueret: et minus exercitatum in practica a laboribus releuaret. Vnde placuit, si tamen licuerit, exemplo Ruth moabitis, post terga messorum spicas colligere. quia doctorum vestigia sequendo: principaliter tamen Speculatoris, domini videlicet Vruilhelmi duranti: qualemcunque laborum ipsorum fructum prout potui studui reportare. Et rogo: ne mihi fratri Ioanni dicto de Stynna, propter hoc si presens opus ad manus aliquorum peruenerit indignentur: cum per hoc necessitati proprie consulerem. qui aliquotiens pro necessitatibus monasterij Colbacensis et ordinis Cisterciensis ad remotiora loca proficiscens, Speculi et aliorum maiorum librorum copiam, ad debitarum formarum, et aliorum que occurebant in iudicijs et extra memoriam habere nequiui. Hec igitur excerpta seu collecta pro viatico mecum ducere statui: in quo diuersorum instrumentorum, tam in iudicijs quam contractibus interuenientium: nec non actorum siue actuum iudicialium, singulorum formas, cum alijs notabilibus que Parisius aliquando a magistro Ioanne de Borbonio et quibusdam alijs reportaui: atque nouorum iurium declarationibus reperiens, indigentie proprie aliqualiter satisfeci. Vgl. Muther (1872) 81.
91 Muther (1872) 2; Landsberg (1894) 99.
92 [Astesanus de Astis] (1519) Proemium, fol. IIIr: Sed tum cupiens consulere penurie mee: vt sic saltem in modico predicti fructus gloriosi possem particeps fieri exemplo Ruth paupercule moabitis ingrediens aliorum agros: doctorum scilicet magnorum scripta studendo diligenter. Vgl. Winteroll (1987) 192f. sowie Michaud-Quantin (1962) 57–60; Bazzichi (2018) 91–104. Zu anderen Nachschlagewerken vgl. Rouse/ Rouse (1979) Appendix 2: Prologue to the Manipulus florum, 236; Palacios (1989) 48, Z. 34–45. Ausdrücklich hervorgehoben wird in der Summa Astensis, dass Ruth eine paupercula war. Vgl. Lv 23,22.
93 Pasciuta (2016); Condorelli (2019). Zum Speculum iudiciale als Gegenstand von Epitomierung allgemein vgl. Nörr (1973) 394f.
94 Johannes Urbach (1873). Vgl. Nörr (2002) 283ff.
95 Boockmann (1972) 509. Zur Person vgl. Boockmann (1999).
96 Muther (1882) insbes. 52 (zu Durantis und Johannes Andreae).
97 Muther (1882) 59 bzw. 62.
98 Nörr (2002) 285.
99 Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 8,1 (1998) 24.
100 Zur neueren rechtshistorischen Diskussion über den Begriff der Rezeption vgl. Schumann (2018) 87ff.; Oestmann (2018) 125–131.
101 Zum Verfasser vgl. Haferkamp (2013). Zum Gegenstand vgl. Kümper (2018).
102 Das Gleiche gilt übrigens für die deutschsprachige Literatur des Spätmittelalters, soweit sie sich dem Umkreis des kirchlichen oder weltlichen Rechts zurechnen lässt. Vgl. Furtenbach/ Kalb (1983); Hamm/ Ulmschneider (1985); Johanek (1986); Johanek (1987).
103 Vgl. Stintzing (1857) 155f.
104 Trusen (1962) 127–134; Becker (1998) 16ff. Dagegen vgl. Wejwoda (2012) 346f.
105 [Seckel] (2004) 516 (vgl. 514f.). Ferner vgl. Seckel (1898) IV.
106 Foca (1974) I,1 Z. 7–8, S. 29: te longinqua petens comitem sibi ferre viator / ne dubitet: parvo pondere multa vehis. Vgl. Mondin (2007/08) 341f.
107 Paulus Aegineta (1921) 3. Vgl. Pieler (2000) 219.
108 Lehmann (1949) 67.
109 Siehe oben Anm. 63. Vgl. auch Weigand (1991) 250.
110 Von Schulte (1870a) 32f.; von Schulte (1870b) 219 Anm. 10; Weigand (1991) 250; Winroth (2000b) 567; Landau (2012) Sp. 533.
111 [Johannes von Zinna] (1511) Pars III, De Regulis iuris, Preludia in Regulas iuris, fol. 176r: […] per quas regulas canonista in itinere pro negociis constitutus, aliosque libros ad manum non habens, in multis casibus poterit subtiliter euadere: et argumentis pro et contra cum notabilibus distinctionibus se iuuare. Vgl. Coing (1964) 203.
112 [Johannes Faber] (1516) Prolog, fol. IIIIr: Labilis memoria: variarum opinionum multitudo: librorum quasi infinitus numerus qui vbique transferri non possunt nec quandoque videri, negociorum frequens occursus: induxerunt me conclusiones glosarum et doctorum iuris ciuilis, et (cum loca occurrerint) iuris canonici in quibus consistit legis perfectio quibus parum aut nihil in facto super codice qui summa est succinctis verbis omissis disputationibus excerpere: in libelo qui vna cum textu codicis referri posset faciliter in maleta. Zu Johannes Faber vgl. Fournier (1921); Boyé (1959).
113 [Johannes Faber] (1516) Prolog, fol. IIIIr: Quem qui[a] breuis et pro itinerante et negociante: et ab itinerante: et negotiante et (vt plurimum) extra librorum presentiam factus est: iudicaui breuiarium nuncupari. Vgl. von Savigny (1850) 43f.; Tardif (1890) 423.
114 [Johannes Berberius] (1536). Vgl. Stintzing (1867) 234–239; Rivier (1873); Lauranson-Rosaz (2009).
115 [Johannes Berberius] (1536) Pars tertia, Sequitur rubrica de successionibus ex testamento, fol. LXXIva.
116 [Johannes Berberius] (1536) Prolog, fol. IIIr: Efficiens [causa, C.M.] quippe fuit redigendi aliqua practicabilia iuris hinc inde dispersa in vnum paruum et portabile volumen quod viatores et signanter aduocati et consiliarij curiarum qui sepe discurrere habent prouincias in eo aliquid practice rememorari valeant. Et licet gratia breuitatis in hoc opusculo allegem duntaxat text. glo. et rationes: casus decidentes: in omnibus tamen semper tam veterum quam modernorum amplexus sum doctorum iuris vtriusque sententias sine quorum doctrina nil me quisquam egisse coniectet et arbitretur. Sed quia si ipsorum recitassem opiniones et iurium adduxissem concordantias multasque subtilitates quas doctores tangunt: parum tamen in practica occurrentes deduxissem nomen operis defecisset cum non vie: sed studio vel camere magis conuenisset.
117 [Johannes Faber] (1516) Prolog, fol. IIIIr.
118 [Johannes Faber] (1557) Prolog, n. 2–3, fol. 2vb. Dazu vgl. Boyé (1959) 28 (insbes. Anm. 14 und 16).
119 Meyer (2006) 377ff.; Kästle- Lamparter (2016) 177.
120 Winteroll (1987) 170ff. Vgl. Winteroll (1987) 195ff., 202f. Zum Prolog der Summa Astensis vgl. Anm. 92.
121 Compendium textuale (1519) fol. CCXLVIIIv: Compendium textuale (mendis non paucis Iamiam expurgatum aurei diuinique Decretalium voluminis adeo nunc felici ac miranda operis exiguitate cohibitum: vt peregre deinceps proficiscentes se angusto codiculo maximam splendidioremque iuris canonici partem nullo glosarum pondere onusti) in forulo, seu marsupio quoquo eant secum detulisse glorientur. Memores illius sententie quam dixisse fertur princeps ille, Juristarum ac practicorum Jo. fabri (glosarum congeriem impense exhorrescens) Per textus bene intellectos omnia haberi […].
122 Zu dieser Ausgabe vgl. Schulz (1883); Savelli (2018) 117. Zu Gilles d’Aurigny vgl. Cioranesco (1959) 97 (Nr. 2908–2917).
123 Digesti veteris (1518) fol. 1v. Vgl. Schulz (1883) 15–16 (Text) sowie 27. Zur Quelle des Zitats vgl. [Johannes Faber] (1557) ad Inst. 3.27 pr. ( De obligationibus, quae ex quasi contractu nascuntur.), fol. 107va: […] vtinam omnes summae et scripta, nisi ea quae pertinent ad intellectum textuum essent deletae; quia per textus bene intellectos omnia habentur.
124 In beiden Fällen taucht nicht nur Johannes Fabers aus dessen Institutionenkommentar stammende Sentenz über die richtig verstandenen Texte auf (vgl. Anm. 121; Digesti Veteris (1518) fol. 1v: Nam per textus sane intellectos omnia habentur), sondern auch das Wort von der glosarum congeries, das im Kolophon mit dem gerade genannten Autor in Verbindung gebracht wird.
125 [Johannes Faber] (1516); Johannes de Vanquel Coloniensis (1513). Zu Johannes Kölner de Vanckel vgl. Gillet (1957); Aubert (2000). Zu Regnaults in diesem Zusammenhang ebenfalls interessanten Decretum Gratiani-Druck, der Teil der Corpus Juris Canonici-Ausgabe von 1519 war, vgl. Adversi (1959) 309, Nr. 27.
126 Aquilon (1982) 358; Aquilon/ Pittion (2009) 332.
127 Dazu mit Blick auf die sog. populäre Literatur vgl. Bertram (2014) 573.
128 Trusen (1971); Trusen (1990). Zur legistischen Literatur vgl. Horn (1973) 284f.
129 Dazu vgl. Duve/ Danwerth (Hg.) (2020). Von den darin abgedruckten Artikeln vgl. insbes. Duve (2020) 30f.; Danwerth (2020); Bragagnolo (2020).
130 Von Schulte (1880) 351 (Bd. 3,3). Ferner vgl. Becker (1772); Becker (1781). In diesen beiden Arbeiten zeigt sich Clemens Becker (1724–1790) mehr an der Geschichte als an der Anwendung des kanonischen Rechts interessiert. Vgl. von Schulte (1880) 232f. (Bd. 3,1). Deutlich mehr als eine bloße Epitome bietet das Werk von Giovanni Battista Scorza (1553–1627). Vgl. Scortia (1625).
131 Duval (1957).
132 Zu den Konzilssummen vgl. Sieben (1988) 235–239 (vgl. auch Sieben [1988] 472–476); Sieben (2018) 179f. (s.v. Summen). Zu Auszügen aus und Repertorien zu Bullarien vgl. von Schulte (1880) 68 Anm. 8 (Bd. 3,1). Eine Sonderstellung kommt Giovannni Domenico Mansis Auszug aus dem Bullarium Benedikts XIV. zu. Vgl. Mansi (1763). Zu den Konstitutionen der Jesuiten vgl. Ruiz Jurado (2010).
133 So z.B. Maranta (1656); de Rives (1663); Brancatus (1659); Schram (1774). Vgl. Naz (1965) sowie von Scherer (1886) 272.
134 Schon von Schulte konnte für Tomás Sánchez’ (1550–1610) in zahlreichen Auflagen erschienenes Werk De matrimonio vier Epitomen nachweisen. Vgl. von Schulte (1880) 737 Anm. 2 (Bd. 3,1). Zu Sánchez vgl. Carrode- guas (2003); Alfieri (2010). Zur Moraltheologie vgl. Grabmann (1947); Hurtubise (2005) 35ff.
135 Vitus Pichler (1670–1736) etwa verfasste sowohl einen umfangreicheren, erstmals 1716–1721 erschienenen Candidatus jurisprudentiae sacrae als auch einen deutlich kürzeren Candidatus abbreviatus, den er erstmalig 1731 veröffentlichte. Beide Werke erlebten mehrere Auflagen. Vgl. Pichler (1716–1721); Pichler (1731). Zu Pichler vgl. Fritsch (2004) 236–247.
136 Zu der Gattung vgl. von Schulte (1880) 353 (Bd. 3,3); von Scherer (1886) 123; van Hove (1945) 544f. Zu Paratitla in Antoine de Mouchys Ausgabe des Decretum Gratiani (erster Druck: 1547) vgl. Landau (2008) 50.
1367 Bibliotheca maxima pontificia (1695–1699); Thesaurus theologicus (1762–1763). Vgl. Phillips (1852) 401–412; Hurter (1911) Sp. 376 (Anm. 2) bis 381 (Bibliotheca maxima pontificia); Hurter (1911) Sp. 494 (Thesaurus theologicus); Sommervogel/ de Backer (1898) s.v. Zaccaria, François Antoine (Sp. 1381–1435), hier Sp. 1403–1406 (Thesaurus theologicus).
138 Vgl. Anm. 2.
139 Reformation de l’Université de Paris (1601), Appendix ad reformationem Facultatis iuris Canonici, art. XIV. Vgl. Périès (1890) 209 Anm. 3. Diese Vorschrift ist auch in den Statuten der Univeristät Rheims von 1662 (Statuta facultatis juris academiae Remensis art. 17) enthalten, allerdings mit Blick auf die juristische Fakultät. Vgl. Archives legislatives de la ville de Reims (1847) 758.
140 Florens (1679) 63; Doujat (1717) 518 (Lib. IV, Cap. 21, n. 11); Gerbert (1754) 118ff. Eine methodisch zum Teil ähnlich gelagerte Kritik am Gebrauch der sog. abridgements findet sich mitunter im frühneuzeitlichen Common Law. Vgl. Holdsworth (1945) 377f.
141 Meyer (2012).
142 So z.B. noch Vermeersch/ Creusen (1949–1956); Serraino (1988). Zur Moraltheologie vgl. Telch (1924); Ferreres (1933).
143 Devoti (1785–1789). Vgl. Lauro (1991); Fantappiè (2008) 121ff.
144 [Tarquini] (1835). Zur Person vgl. Fantappiè (2008) 158–163; Nacci (2010) 60–79.
145 Meyer (2000a); Meyer (2000b); Speer (2012) 239–242; Wittekind (2018); Dusil (2018b). Ferner vgl. Stein (1916); Schadt (1982); Musson (2014); Blair (2010) 144–152; Röhl (2010).
146 Moore (1936) 81–83; Worm (2012); Worm (2018); Grosseteste (1984); Ransom (1999).
147 Possevinus (1593) (Lib. XII cap. XIX) 38f.; Burmeister (1974) 230; Holthöfer (1977) 135; Prinz (2006). Ferner vgl. Brendecke (2015).
148 So z.B. Girardus (1551); Haemstedius (1552); Tinctus (1583); Ugolinus (1587); Pacius a Beriga (1616); Le Masson (1662); Kurtz (1761/62/64); Goritia (1796); Cappelli (1819). Für einige Beobachtungen zu dieser Praxis, vgl. Wex (1708) Tabula IV., membrum IV, 21–22. Besonders bemerkenswert erscheint die Verwendung graphischer Darstellungen im Zusammenhang mit den wirkungsgeschichtlich sehr bedeutsamen, erstmals 1563 publizierten Institutiones iuris canonici des Giovanni Paolo Lancellotti (1522–1590). Schon in der Ausgabe des Jahres 1583 finden sich erste (kleinere) Schemata. In den eben zitierten Tabulae sive introductiones des Giulio Cesare Tinti ist dann – genauso wie etwas mehr als zweieinhalb Jahrhunderte später bei Tarquini – die in einem fortlaufenden Text gehaltene Darstellung (Lancellottis) einer weitgehend graphisch-schematischen Aufarbeitung der entsprechenden Inhalte gewichen. Vgl. Lancellottus (1583); Sinisi (2004) 66, 79. Zur protestantischen Moraltheologie vgl. etwa Olearius (1694); Buddeus (1721); Walchius (1758). Zu volkssprachigen Darstellungen vgl. z.B. de Lesclache (1675); Monnier (1857).
149 So z.B. Manassero (1903–1907); Berthier (1931). Vgl. auch [Anon.] (1930); Santamaria (1949). Zur Rechtswissenschaft vgl. Steinhauer (2015) 137–161.
150 [Tarquini] (1840).
151 Zum Verfasser vgl. Hurter (1911) Sp. 1353; Aubert (2015).
152 Zum Gallikanismus vgl. Gaudemet (1991); Basdevant-Gaudemet (2014) 486–523.
153 Mosiek (1959) 41.
154 [Lequeux] (1845).
155 Lequeux (1843/44).
156 Gough (1986) 151–161; De Franceschi (2017).
157 [Lequeux] (1845) I.
158 [Tarquini] (1835) 2: Ingens sane subsidium memoriae in Tabulis consistit, in quas doctrinae ita referuntur, ut uno quasi conspectu comprehendi earum ambitus possit. Christian. Wolph. Disert. de Tabular. Mnemonic. construct. et usu. Vgl. Wolff (1732) 470f. sowie Fantappiè(2008) 163 Anm. 158.
159 Siehe oben Anm. 66. Ferner vgl. Heimann-Seelbach (1996).
160 Schönberger (1991) 83.
161 Vgl. S. 37.
162 So sollen etwa die als Lehrbuch geschätzten Principia iuris canonici Georg Ludwig Böhmers (1715–1797), ein abstrahierendes Kompendium, das das umfangreiche Werk Justus Henning Böhmers (1674–1749), des Vaters des Verfassers, kondensiert, die Grundlage für die Redaktion der kirchenrechtlichen Partien des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794 gebildet haben. Vgl. Richter (1865) 11; Dove (1867) 297 Anm. 17; von Schulte (1880) 136 (Bd. 3,2–3); Löhr (1917) 20 Anm. 2, 116 Anm. 1. Zu den beiden Verfassern vgl. de Wall (2008a); de Wall (2008b).